
Badlands National Park
Wir sind früh auf den Beinen, denn noch trennen uns 300 Meilen vom ersten Haltepunkt im Westen, den Badlands. Dreihundert Meilen, also fast 500 km, das entspricht einer Tagesfahrt, weil das Land immer wieder Überraschungen bereit hält und zu kurzen Fotosafaris animiert.
Von einem Tag auf den anderen scheinen sich die Schwerpunkte in der Umgebung verschoben zu haben, setzten Mensch und Umwelt neue Akzente. Gestern noch beherrschten turmhohe Silos, ausgedehnte Agrarflächen, stattliche Farmen, also alle nur erdenklichen Spielarten von Getreideanbau und -verwertung und die kleinen und mittleren Städte entlang der Haupteisenbahnlinien die Szenerie. Heute ist dieses Bild deutlich verändert. Schon hinter Sioux City verschwinden die Städte, Grasland unterbricht die Monokulturen, verschafft sich mit jedem Kilometer in Richtung Rocky Mountains mehr Raum. Kaum merkliche Schwingungen im Auf und Ab der Great Plains des Mississippibeckens weichen nun zunehmend grünen Hügeln. Hier in diesem Vorfeld des Felsengebirges ist die Experimentierküche der Präriegräser, einst von Südkanada bis Texas reichend, noch intakt. Das verleiht diesem Landstrich etwas urwüchsiges, manchmal auch unwirtliches.
Auch klimatisch bahnt sich ein Umschwung an. Wir sind ja nicht nur nach Westen, sondern auch weit in den Norden der Vereinigten Staaten vorgedrungen. Eisige Winter mit Temperaturen bis minus 40°C sind hier keine Seltenheit, Winter mit Blizzards, welche die Farmen mitunter mehrere Tage lang von der Außenwelt abschneiden, Tage in denen die Familien, auf sich alleine gestellt, ausharren müssen. Die kürzeren Wachstumsperioden und die kargeren Böden zwingen zu Mischwirtschaft. Die Höfe weniger prunkvoll, der Maschinenpark erheblich reduziert, unter dem Strich aber lebendiger mit Kühen, Pferden, Borsten- und Federvieh eher unserem Klischee einer heilen Welt entsprechend.
Zeugnisse menschlicher Aktivität rücken nun mehr und mehr in den Hintergrund - hier ein paar Zäune, dort vereinzelte Heuballen, in der Ferne eines jener für den semiariden Westen der USA so typischen metallenen Windräder, als weithin sichtbarer Außenposten der Zivilisation. Es ist, als wolle uns die Umgebung auf "bad land", was ja Ödland, was wüstenhaftes, lebensfeindliches Land meint, vorbereiten. Innerlich schon auf das aride Inferno eingestellt trifft uns ein plötzlich sich auftuendes Meer gelb blühender Gräser unvorbereitet und löst ein Wechselbad der Gefühle aus.

Schließlich naht die Interstateausfahrt, nur noch wenige Meilen sind zurückzulegen, aber vom Park keine Spur. Die tief stehende Sonne wirft ihr rötlichgelbes Licht auf Büsche und Gräser. Ungeduldig suchen wir den Horizont ab, wohl wissend, dass es nicht mehr allzu weit sein kann. Doch nichts tut sich. Dann endlich, mit einem Male kräuselt sich der Horizont. Die sanft geschwungene Grenzlinie, die grünes Hügelland und Himmelsblau trennt, schaltet Zacken ein und wächst zu einer rötlich-weißen Wand, die am Ende als steinerne Burg mit Zinnen und Türmchen vor uns steht. Die Straße umkurvt elegant die steinerne Festung und erschließt was diese eben noch verbarg. Vor unseren Augen öffnet sich eine phantastische neue Welt, bestehend aus unzähligen meter-, manchmal auch zehnermetertiefen Schluchten, die steil ansteigende Hänge und kleinflächige Plateaus abtrennen.
Die hämatitrot und weiß gebänderten Hänge der Canyons bringen das Grün und Gelb der Gräser auf den Plateaus noch besser zur Geltung. Wo die Vegetation völlig fehlt, nimmt das Gelände den Charakter einer aufregenden aber fremden und unheimlichen Mondlandschaft an.
Die Gesteine, überwiegend Lockersedimente, welche während des Aufstiegs der Rockies im Erdmittelalter als Flußablagerungen vor der Gebirgsfront Platz nahmen und Aschen aus vulkanischer Tätigkeit im Yellowstone-Gebiet, die die Westwinde in den Bereich der Badlands verfrachteten, wechseln vertikal in ihrer Festigkeit. Einzelne harte Lagen im oberen Teil des Schichtenpaketes werden von den erodierenden Kräften als rauhe, scharfkantige, wildzerklüftete Steilstufen herauspräpariert. Sie kontrastieren die weichen Konturen sanft ansteigender, halbkreisförmig vor- und zurückschwingender Kegel tiefer liegender Abschnitte, deren Hangflächen dendritisch verzweigte Abflussrinnen und -kanälchen zieren.
Weiter entfernt liegende Areale wirken im Spiel von Licht und Schatten wie Dünenfelder. Wandert man durch die Canyons, streift mit der Hand an der einen oder anderen Stelle über den Hang und löst die erhärtete Kruste, so lässt sich das nunmehr ungeschützte Material leicht mit dem Finger heraus pulen. An steileren Partien brechen manchmal ganze Fladen krümeligen Gesteins herunter.
In den Badlands werden außerordentlich hohe, gar rekordverdächtige Erosionsraten erreicht. In Extremfällen können wenig verfestigte Aschenlagen in einem Jahr zehn bis fünfzehn Zentimeter an Höhe verlieren. Verantwortlich hierfür zeichnen das semiaride Klima mit heftigen Ruckregen, welche auf eine unzureichende Pflanzendecke niederprasseln, die geringe Verfestigung der Sedimente sowie Frostsprengung und ein hoher Ton- und Lehmanteil, der zu verstärktem oberirdischen Abfluss beiträgt. Heftige Schauertätigkeit vermag ganze Hänge mit einem Male abrutschen zu lassen, die dann in den Canyons kleine Seen aufstauen. Das Bersten eines solchen künstlichen Staudamms bringt Schlammlawinen ins Rollen, die alles mitreißen, was sich ihnen in den Weg stellt. Infolge der enormen Materialabfuhr entstand eine fast hundert Kilometer lange und zehn Kilometer breite Ödlandzone, die oberhalb des White River durch rückschreitende Erosion allmählich nach Norden wandert.

Die nur mäßig verfestigten Sedimente (Absetzgesteine) werden im Winter durch Eis und Schnee (Frostsprengung) und im Sommer durch hohe Tagestemperaturschwankungen und Niederschläge aufgelockert und zerkleinert, sodann durch Wind, vor allem aber gelegentliche Starkregen umgelagert und fortgespült. Dabei kann es auch zur Ausbildung von Schlammströmen kommen. Irgendwann erreichen die auf diese Weise umgelagerten Sedimente den Fluss, der die gesamte Fracht an Sedimenten aus der Region wegführt.

Die Einheimischen bezeichnen diese Zone etwas abschätzig als Wall, also Wand oder Mauer, weil sie die Prärien South Dakotas zweiteilt und dadurch vor allem den frühen Siedlern erheblich zu schaffen machte. Ganz angetan von der Nordwanderung der Badlands sind allerdings die Paläontologen; legte sie doch unter anderem Schichten des Mittleren Tertiärs (Oligozän) frei, welche eine reiche Wirbeltierfauna enthalten, die besonders gut die Entwicklung der Säugetiere jener Zeit dokumentiert.
Eines empfinden wir nach den Erfahrungen im dichtbesiedelten Osten als besonders angenehm. Trotz Hochsommer, Ferienzeit und vollbesetztem Campingplatz verlieren sich die Besucher in der Weite des Raumes. Sobald man an einem der Viewpoints die Straße verlässt und in die kleinen Schluchten hinabläuft, ist man alleine, wandelt durch scheinbar unbelecktes Terrain, umgeben nur vom eigenen Echo.
Eine ganze Weile folgen wir fotografierend den geschwungenen kleinen canyons, erklimmen den einen oder anderen Aussichtspunkt um kurz zu rasten und entfernen uns auf diese Weise immer weiter von unserem rollenden Heim. Abgesehen von einigen wenigen Vögeln deutet nichts auf tierisches Leben hin, vermutlich sind wir dafür aber auch einfach zu laut oder die „Nachtschicht“ hat noch nicht begonnen. Trotzdem ist uns nicht so ganz wohl bei dem Gedanken den Streifzug durch unbekanntes Terrain im Dämmerlicht immer weiter fortzusetzen, schließlich ist hier im Westen durchaus mit Schlangen zu rechnen und so orientieren wir uns irgendwann doch in Richtung der Straße, um dort festzustellen, dass wir uns ein gutes Stück von unserem Van entfernt haben. Nachdem wir den ganzen Tag dieser beeindruckenden Landschaft entgegenfieberten, waren wir nun, da sie sich so verschwenderisch vor uns ausbreitete, so überwältigt, dass wir wieder einmal vollkommen vergessen haben, rechtzeitig einen geeigneten Schlafplatz zu suchen. Als wir endlich unser rollendes Heim erreichen, ist es schon richtig duster. Wir verlassen den Park, irren eine ganze Weile auf unbekannten Landstraßen durch die Prärie, um reichlich spät und nach mühevoller Suche endlich einen geeigneten Abstellplatz am Rande einer Landstraße zu finden, der uns ausreichend sicher erscheint. Bei Kerzenlicht bereitet Angelika unser Nachtmahl, das mangels Einkaufsmöglichkeiten heute etwas spärlich ausfällt. Der vor wenigen Stunden noch tiefblaue Tageshimmel zeigt sich jetzt als blauschwarzes Meer mit Myriaden von Sternen. Über dem ganzen Land liegt eine unsägliche Stille. In der Ferne wandern kleine Lichtpunkte von vereinzelt sich über die Landstraßen bewegenden Fahrzeugen den Horizont entlang. Ein wenig verloren kommen wir uns schon vor, aber in wenigen Stunden bricht der neue Tag an und nachdem uns bisher niemand behelligt war, schließen wir die Luken und legen uns nieder.
Als wir aufwachen, steht die Sonne bereits hoch am Firmament. Dass es so spät geworden ist, liegt nicht nur an den Anstrengungen des Vortages. Zum wiederholten Male hatten wir einen nächtlichen Besucher, vermutlich eine Maus deren ständiges Bemühen sich an unseren Vorräten zu laben, besonders Angelika sehr zu schaffen machte. Sie hat ohnehin einen leichten Schlaf und wird von eindeutigen Geräuschen dieser Art sehr schnell aufgeweckt. Dabei nervt sie am wenigsten, dass irgendwelche Nager an unsere Vorräte gelangen könnten, die seien ihnen gegönnt. Sollte sie am folgenden Morgen Fressspuren erkennen, würden die Lebensmittel einfach weggeworfen und das Problem wäre erledigt. Die Vorstellung aber, die Tierchen könnten sich auf ihrem Weg durch unseren Van auch nur in die Nähe von Angelikas Nachtlager verirren, lässt sie erschaudern. Mindestens genauso schlimm ist, dass solche Ereignisse dank eines überaus guten Schlafes regelmäßig an mir vorbeigehen. Und das ist überhaupt nicht lustig! Also werde ich in solchen Fällen durch heftiges Schubsen so lange in Schwingungen versetzt bis ich genervt aufwache, auf dass auch ich Teil habe am nächtlichen Drama. Sodann wird mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil, Angelika vor dem Drachen zu retten. Der agiert jedoch so geschickt, dass ich bei Kerzenlicht, übermüdet im unaufgeräumten Van herumstolpernd nicht den Hauch einer Chance habe, dem Treiben des Eindringlings ein Ende zu setzen. Wenn ich das Gefühl habe meinen guten Willen ausreichend dokumentiert zu haben, sodass auch mein Weib die Sinnlosigkeit meines Unterfangens erkennt, versuche ich Angelika davon zu überzeugen, dass der Eindringling nicht an uns, sondern ausschließlich an unseren Vorräten interessiert ist. Nach längerem Zureden tauschen wir anschließend die Bettseiten, damit im Zweifel ich und nicht sie dem Feind von Angesicht zu Angesicht gegenüber liegen muss. Und so schaffen wir es gelegentlich auch noch vor Tagesanbruch wieder einzuschlafen. Ja, und so steht dann eben das Himmelsgestirn schon fast im Zenit, als wir unsere Vorhänge zurückziehen, um den neuen Tag zu begrüßen.
Im Zuge unserer nächtlichen Irrfahrt sind wir so weit abgetrieben, dass uns nun wieder der grüne, nahezu baum- und strauchlose Teppich am Rande des Parks umgibt. Nachdem wir uns tagfein gemacht haben, setzen wir unser Gefährt in Bewegung, haben aber zunächst einige Orientierungsprobleme. Erst als die Interstate wieder vor unseren Augen auftaucht, finden wir zurück zu den Badlands. Als das gelbe Blumenmeer wieder in das vegetationsarme Labyrinth übergeht, ist der abendliche Zauber verflogen. Im hellen Sonnenlicht fehlt der Kontrast und so kommen die weiß-rot gebänderten Hänge nun weit weniger zur Geltung als gestern bei tiefstehendem Himmelsgestirn.
Auch heute begeben wir uns wieder in eine der kleinen Schluchten und folgen ihrem geschwungenen Lauf in das bis zum Horizont reichende steinerne Meer. In feuchteren Tälchen konnte sich der grüne Teppich, der die Badlands weiträumig umschließt auch innerhalb dieser ansonsten kargen Landmasse ausbreiten. An anderer Stelle treffen wir neben den weiß-rot gebänderten Hängen auch auf gelbbraune Gesteinsmassen, welche die weiß-roten Bänder vorzüglich kontrastieren. Glauben wir an einem Ausstiegsort die interessantesten Punkte gesehen zu haben, so kehren wir zurück zum Fahrzeug und machen View-Point-Hopping. Überall wo es interessant erscheint, halten wir an und beginnen die nächste Wanderung. An einem der Rastplätze treffen wir gelegentlich auf US-Amerikaner, die uns ansprechen und staunen, dass wir, unser Nummernschild zeigt dies jedenfalls an, den langen Weg vom „Garden State“ New Jersey bis in diese Einöde auf uns genommen haben. Noch erstaunter sind sie dann natürlich, wenn sie erfahren, dass unserer Heimat noch etwas weiter östlich liegt. Von ihnen erhalten wir wertvolle Hinweise, wo es sich lohnt die Straße zu verlassen und die Umgebung zu erkunden.
Trotz des dünnen Straßennetzes zeigt sich auch heute nur wenig Verkehr. Viele Besucher beschränken sich auf einen kurzen Ausstieg an den verschiedenen Viewpoints und so verlieren sich jene, die in die Schluchten vordringen, schnell in den Weiten des Labyrinths. Aus benachbarten Canyons hört man gelegentlich Stimmen, die nahe zu sein scheinen. Erklimmen wir aber einen der Kämme und versuchen den Eindringling zu orten, so wandert dieser häufig in deutlicher Entfernung durch die steinernen Gänge oder bleibt unserem Auge hinter allerlei Windungen vollständig verborgen. Von einem etwas höheren Hügel aus sehen wir in der Ferne sattes Grün, auf dem sich Wild tummelt. Vermutlich sind es Antilopen, doch die Tiere sind einfach zu weit entfernt, um das genau erkennen zu können.
In den Badlands haben wir einen ersten Vorgeschmack erhalten auf das, was nun noch kommen mag. Stille und Einsamkeit, unermessliche Weiten, raue unbarmherzige Natur, Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Wir durften an all dem schnuppern und es gefällt uns, davon hätten wir gerne noch mehr.
Die Black Hills
Unsere nächste Station sind die Black Hills, die wir aber heute, wegen des fortgeschrittenen Tages nicht mehr erreichen werden. An einer Ausfallstraße werden wir auf
den Parkplatz eines Supermarktes aufmerksam, der zudem von mehreren Fastfood-Restaurants gesäumt ist.
In den letzten Tagen konnten wir uns in den wenigen Läden entlang unseres Weges nur mit den wichtigsten Dingen des alltäglichen Bedarfs eindecken. Da wir
beabsichtigen auch die nächsten Tage wieder im ländlichen Raum zu verbringen, macht es deshalb Sinn die Vorräte hier aufzufüllen und so entschließen wir uns zu einem ausgiebigen
Einkaufsbummel. Nachdem wir in der näheren Umgebung kein geeignetes Nachtlager ausfindig machen können, entschließen wir uns auch die Nacht hier zu verbringen. Wir standen schon idyllischer, fühlen uns aber wegen der guten Versorgung und der Anonymität dieses recht großen und bis in den späten Abend belebten Parkplatzes trotzdem
ganz wohl. Und eine etwas ausgiebigere Rast tut uns auch mal ganz gut.
Auf den Einkauf folgt ein ausgedehntes Abendessen, danach strecken wir unsere müden Glieder so gut es geht. Tatsächlich geht es eher schlecht, denn wir liegen immer noch auf unserem Trapezblechboden. Obwohl wir es inzwischen geschafft haben unser hartes Nachtlager durch das Einbringen einiger Lagen Wellpappe etwas komfortabler zu gestalten, hält sich die nächtliche Erholung eher in Grenzen. Immerhin war es in den ersten drei Wochen unserer Reise überwiegend warm bis sehr warm, so dass wir neben den Isomatten auch die Schlafsäcke noch als Unterlager verwenden konnten, was die Sache um einiges verbesserte. Nachdem wir nun aber in den Rockies angelangt sind, stellen sich auch kühlere Nächte ein und so schläft man am Abend bei moderaten Temperaturen auf dem Schlafsack ein, um mitten in der Nacht, leicht fröstelnd sich doch noch in denselben zu verkriechen und dabei den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben.
Da um uns herum immer noch reges Treiben herrscht, nutzen wir die Gelegenheit versäumte Tagebucheinträge nachzuholen. Normalerweise ist das meine Aufgabe, aber nachdem ich in den letzten Tagen ziemlich geschludert habe, erbarmt sich Angelika. Bis sie endlich die Chronologie der Ereignisse schriftlich fixieren kann, gilt es eine gute Stunde lang sämtliche Aufzeichnungen zu durchforsten und unser Gedächtnis mit bohrenden Fragen zu löchern.
Während sie schreibt, kümmere ich mich um die Buchführung. Auch wenn es nervig ist, macht das Bilanzieren Sinn, denn nur so behält man den finanziellen Überblick und wenn man wie heute feststellt, dass wir in den letzten Tagen endlich einmal unterhalb des vorgegebenen Limits geblieben sind, dann kann das auch richtig Spaß machen.
Nachdem der Einkaufstrubel abgeebbt und um uns herum Ruhe eingekehrt ist, bereiten wir unser Nachtlager und versuchen zu schlafen. Doch die hell erleuchteten Reklametafeln machen dies zu einem schwierigen Unterfangen. Und so rekapitulieren wir die vergangenen Tage, überlegen wie es wohl unserer Familie zuhause gehen mag und schmieden neue Pläne für die vor uns liegenden Wochen.
Als wir endlich einschlafen können, ist es schon weit nach Mitternacht, doch der Schlaf währt nicht lange. Schon 2 Stunden später ist es mit der Nachtruhe wieder vorbei. Wach auf, wach doch auf, vernehme ich Angelikas ängstliche Stimme neben mir. Ich denke in diesen Fällen immer zuerst an einen Sheriff oder Anwohner, dem wir im Wege sind. Doch es ist unser nächtlicher Besucher, den wir vermutlich aus den Badlands in die Black Hills verschleppt haben und den es nun wieder nach einem nächtlichen Mal drängt. Die ungestüme Weckaktion und meine Unmutsäußerungen müssen das Tierchen verschreckt haben und lassen es innehalten und so hören wir zunächst einmal überhaupt nichts.
Als wir gerade wieder kurz vor dem Einnicken sind, setzt unter unserer Spüle ein Knistern und Rascheln ein das jeden Zweifel beseitigt. Ich habe sogar den Verdacht, dass unser Freund Zuwachs bekommen hat. Angelika macht unmissverständlich klar, dass das „Vieh“ raus muss, weil sie ansonsten kein Auge zu bekommt. Also zünde ich eine Kerze an, greife aus dem Feuerholz einen Stock und fuchtele im Halbdunkel zwischen den Essensvorräten herum. Das bringt unseren "Freund" etwas ins Schwitzen, kann ihn aber nicht bewegen, den reich gedeckten Tisch kampflos aufzugeben. Kaum verhalte ich mich eine Weile ruhig, startet er trotz Kerzenlicht den nächsten Versuch an die Objekte seiner Begierde zu kommen. Also beginne ich wieder, ständig der Geräuschkulisse folgend mit meinem Stock im Trüben herumzustochern und richte dabei auch einigen Flurschaden an. Dieses Spielchen geht eine ganze Weile ehe ich, wie üblich entnervt aufgebe.
Angesichts der weiter bestehenden Bedrohung tauschen Angelika und ich wieder einmal die Bettseiten, finden aber keinen Schlaf mehr weil es immer wieder irgendwo knistert, raschelt, kratzt, weil Tassen und Gläser klingeln oder Besteck aus der Halterung fliegt.
Unruhig in den Schlafsäcken hin und her rutschend, verbringen wir den Rest der Nacht. Gegen 4 Uhr morgens reißt uns der Geduldsfaden. Frustriert gestehen wir unsere Ohnmacht ein. Bevor weiteres Porzellan zerschlagen wird, stelle ich die untauglichen Versuche, die Nachtruhe wieder herzustellen, endgültig ein. In spätestens einer Stunde wird es hell sein. Warum länger hier herumliegen? Fahren wir also los, frühstücken nach Sonnenaufgang an einem gemütlichen Plätzchen und vergessen all den Ärger bei einer Tasse Kaffee.
Bald liegen die hellerleuchteten Ausfallstraßen Rapid Citys hinter uns. Auf urbane Konglomerate, endlose Getreideflächen, grasbewachsene Hügel und zerschluchtetes Ödland folgen die dunkelgrünen Nadelwälder der Black Hills, einer Mittelgebirgslandschaft am Rande der Rocky Mountains.
Geologisch betrachtet handelt es sich bei diesem "Gebirge" um einen sogenannten Dom. Im Klartext heißt das: Ursprünglich flach lagernde Sedimentgesteine auf Meeresspiegelniveau wurden rund 2000 Meter angehoben und dabei einem Uhrglas ähnlich konvex aufgewölbt.

Schematische Darstellung eines Doms. Als "Dom" bezeichnet man in der Geologie eine uhrglasförmig (konvex) aufgewölbte Struktur. Sie entsteht, wenn Gesteine der tieferen Erdkruste aufgeschmolzen werden und aufgrund ihrer geringeren Dichte in Richtung Erdoberfläche aufsteigen und dabei das über ihnen befindliche Deckgebirge aufwölben. Die Schmelzen selbst bleiben infolge nachlassender Wärmezufuhr irgendwann stecken, kristallisieren sehr langsam - das kann mehrere Millionen Jahre dauern - aus und bilden großvolumige Tiefengesteinskörper (Plutone). Wenn die Erosion im Laufe geologischer Zeiträume die sedimentären Deckschichten abgeräumt hat, kommen nach und nach die Tiefengesteine zum Vorschein. Der granitische Tiefengesteinskörper ist in den Black Hills fast über die gesamte Längsachse des Domovals sichtbar.
Die einst horizontal liegenden Sedimentgesteine sind nun, wie im Blockbild skizziert, allseitig nach außen geneigt, der Geologe sagt: Sie fallen allseitig nach außen ein. Weil wir es aber mit einem Gebilde von ca. 240 km Länge und 100 km Breite zu tun haben, ist der Betrag des Einfallens derartig gering, dass man es beim Durchfahren dieser Struktur überhaupt nicht bemerkt. Darüber hinaus haben die Verwitterung und ein ständiger Materialtransport durch Schwer- und Wasserkraft dafür gesorgt, dass die Grenzen der einzelnen Gesteinsschichten in der Regel nicht wie im Blockbild dargestellt als deutliche Geländestufen stehen geblieben sind, sondern in der Regel eingeebnet wurden und meist mit einer Vegetationsdecke überzogen sind, so dass sich die Grenzen kaum merklich nur dem aufmerksamen Beobachter erschließen.
Während die ersten Sonnenstrahlen die Schleier der Nacht vertreiben, dringen wir immer tiefer in die Black Hills ein. Die ausgedehnten Wälder, welche sich bisher nur schemenhaft vor dem Hintergrund eines schwach erleuchteten Horizonts abzeichneten, zeigen nun ihr dunkelgrünes Kleid in voller Pracht. Aus ihnen steigen mehr und mehr granitische Felsburgen empor. Dies zeigt uns an, dass wir das Zentrum des Doms erreicht haben. Weil die Erosion hier das sedimentäre Deckgebirge abgetragen hat, kommen die sogenannten kristallinen Gesteine des tieferen Untergrundes - das sind die oben erwähnten Granite - zum Vorschein.

Von den höhergelegenen Felsburgen aus fällt der Blick weit in das Hinterland. Folgt man den granitischen Türmen in die Ferne, so ist anhand ihrer Anordnung die etwa Nord-Süd-verlaufende Längsachse des Domovals auszumachen.
Unter den zahlreichen steinernen Inseln im Wäldermeer hat es eine zu besonderem Ruhm gebracht. Es handelt sich um den Mount Rushmore, einen Gipfel, den der schwedisch-amerikanische Bildhauer Gutzon Borglum auserkor, Rohling für die Büsten von vier amerikanischen Präsidenten zu sein.
Zwischen den zwanziger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden die Porträts von George Washington, General im Unabhängigkeitskrieg gegen England und 1. Präsident der USA, Thomas Jefferson, einem der Väter der amerikanischen Verfassung und 3. Präsident der USA, sowie Theodor Roosevelt, Mentor des Nationalparksystems und 26. Präsident der USA. Vierter im Bunde ist Abraham Lincoln, der während des Bürgerkrieges die Einheit der Nation erhielt und als 16. Präsident der USA das Ende der Sklaverei einleitete.
Schon während der Errichtung dieses monumentalen Bauwerks strömten hunderttausende Neugieriger in die Black Hills. Heute geht die Besucherzahl in die Millionen. Längst ist es eine Art Wallfahrtsort, ein Mekka für nationalbewusste US-Amerikaner geworden, mit allem Pomp, der hierzulande dazugehört.

Am Fuße des Monumentes errichteten die Amerikaner ein Amphitheater, das man von den höhergelegenen Verwaltungsgebäuden über einige Treppen erreicht. In den zahlreichen Fotos, die ich bereits von diesem Monument gesehen hatte, kamen mir die etwa 20 Meter hohen Köpfe viel gewaltiger vor als sie nun tatsächlich über uns erscheinen, insofern bin ich fast ein wenig enttäuscht. Aber der Aufwand, der betrieben werden musste, um diese monumentalen Skulpturen zu erschaffen, ist am Gesteinsschutt, der sich unter der Felswand auftürmt erkennbar und das flößt schon gehörigen Respekt ein.
Aufgrund der nächtlichen Eskapaden findet unser erster Besuch am Mount Rushmore gegen 5 Uhr in der Früh statt. Nicht allzu viele verirren sich um diese Zeit hierher. Die einzigen sind wir aber keineswegs und da wir ja nur aus der nächtlichen Not eine Tugend gemacht haben, frage ich mich schon was mag wohl die anderen zu so früher Stunde hierher getrieben haben. Die Antwort erhalten wir einige Tage später, als wir von Norden kommend auf dem Weg zum Windcave National Park noch einmal bei „Normalbetrieb“ hier vorbeischauen. Gloriagesänge und Hymnen, Touristentrubel und Lightshow, mögen in den Augen Anderer notwendige Begleiterscheinung sein, einem Europäer kann es den Appetit verderben wenn gar zu dick aufgetragen wird. Und so erwiesen sich dieses Mal nicht die letzten sondern die ersten Eindrücke als die Bleibenden und es gibt offensichtlich auch einige Amerikaner denen der Rummel hier auf den Senkel geht.
Immer noch leicht in Trance wegen unserer schlaflosen Nacht folgen wir von Mount Rushmore aus der Straße 244. An einem mit Parkbänken ausgestatteten Overlook machen wir Rast. Die Sonne sorgt für behagliche Wärme und weckt neue Lebensgeister. Angelika nimmt unseren Coleman-Stove in Betrieb und versorgt uns erst einmal mit Kaffee, unserem Lebenselexier. Dann frühstücken wir ausgiebig und studieren die Karten, um weitere lohnenswerte Ziele in der Umgebung auszuspähen, die wir in den nächsten Tagen besuchen wollen. Dabei erinnern wir uns, dass wir ja mit dem einen oder anderen nächtlichen Besucher noch ein Hühnchen zu rupfen haben.
Mein Schlaf ist mir heilig und so bin ich fest entschlossen, den ganzen Van auseinander zu nehmen, bis ich den Eindringling gefunden habe. Stück für Stück räumen wir unser rollendes Heim nun aus, starten eine große Spülaktion stellen jede Schachtel, jeden Topf einfach alles auf den Kopf ohne die geringste Spur des nächtlichen Störenfriedes finden zu können.
Entweder haben wir ihn bereits in der Nacht mehr erschrecken können als uns das bewusst war und er hat unser Domizil längst verlassen oder er hat erkannt, dass es ihm nun an den Kragen gehen könnte und kurzfristig das Weite gesucht, ohne dass es uns aufgefallen wäre. Was mir Kopfzerbrechen macht ist, dass ich den Einstieg der Plagegeister nicht finden kann. Meine Sorge ist, dass Einstiege für Nager prinzipiell auch für Schlangen geeignet sind und das wäre dann auch für mich eine Horrorvorstellung.
Wie dem auch sei, zunächst einmal sind wir den oder die Plagegeister los und dürfen nun davon ausgehen, dass die kommenden Nächte deutlich erholsamer werden. Mit diesem Gefühl bringen wir unser rollendes Heim wieder in seinen ursprünglichen Zustand und setzen unseren Weg durch die Black Hills fort.
Mehrere Tage durchstreifen wir nun ohne festes Ziel die Black Hills, klettern in steinernen Labyrinthen herum, füttern Chipmunks, die sich in großer Zahl an stark frequentierten Aussichtspunkten entlang der Straßen einfinden und fotografieren was interessant erscheint.
Rasch fällt uns die große Auswahl an Mineralien in den Souvenirläden auf. Häufig schmücken zentnerschwere Lasten in rosarot, cobaltblau oder malachitgrün die Ladenfronten. Findige Geschäftsleute wissen eben um die fast magische Anziehungskraft dieses natürlichen Reichtums. Bei den Preisen würde Angelika am liebsten groß einkaufen gehen, aber wo sollen wir den ganzen Plunder unterbringen. Nicht jedes Stück, das verkauft wird, stammt aus den Black Hills, aber die verschwenderische Fülle in den Auslagen und die erstaunliche Größe einzelner Objekte lassen erkennen, dass viel auch vor Ort zu finden ist. In der Tat bildeten sich bei der Entstehung des Doms zahlreiche Mineralparagenesen, das sind Vergesellschaftungen von Mineralien, die entweder als Nebenprodukt des Bergbaus oder gezielt zur Gewinnung von Schmuckstein abgebaut wurden und werden.
Touristen, die die Region schon seit Jahren kennen, raten uns, weiter in den Süden zu fahren, dort im Wind Cave National Park befinde sich eine der letzten Bisonherden. Einzelne Tiere sahen wir schon des Öfteren, aber eine ganze Herde, das mögen wir doch nicht so recht glauben. Weil der Park aber ohnehin auf unserem Wunschzettel steht, machen wir uns kurzentschlossen auf den Weg.
In den letzten Tagen haben wir keine großen Strecken zurückgelegt und so fanden wir immer rechtzeitig einen geeigneten Platz für die Übernachtung und sind fast schon tiefenentspannt. Auch heute begeben wir uns schon am frühen Nachmittag auf einen Campingplatz in der Nähe des Wind Cave National Parks um uns diesen am folgenden Tag einmal anzuschauen.
Wieder einmal verhilft uns unser Autokennzeichen zu allerlei Small Talk, denn von allen Besuchern haben wir die weiteste Anreise, und das macht doch den einen oder anderen neugierig. Auch mit unseren direkten Platznachbarn, einer jungen vierköpfigen Familie aus Chicago kommen wir ins Gespräch. Am Mittag bleibt es beim Small Talk, weil die beiden Kinder alle Aufmerksamkeit benötigen. Für den Abend lädt uns Kim, der von Beruf Rechtsanwalt ist zu einem Marshmallow-Barbequeu ein.
Als die Kinder schließlich im Bett sind, läutet Kims Frau zum gemütlichen Plausch. Die Familie macht ihren ersten längeren Urlaub, was in den Staaten selten mehr als 2 bis 3 Wochen bedeutet. Sie wollten schon immer einmal in den Westen und haben sich diesen Traum nun erfüllt. Sie sind erstaunt, dass wir den Mut hatten vorerst aus dem Beruf auszusteigen und unseren Traum zu leben ohne genau zu wissen wie es danach weitergehen würde. Gerne würden sie einmal nach Europa verreisen, sich London, Paris oder Rom anschauen und so bitten sie uns im Rahmen unserer Möglichkeiten Bericht zu erstatten, welcher Ort wohl der interessanteste wäre. Danach berichten alle von ihren jüngsten Erlebnissen in der näheren Umgebung und so erhalten wir wieder einmal wertvolle Tipps für die weitere Reise. Auch Kim bestätigt uns nochmals im Wind Cave National Park eine Bisonherde gesehen zu haben, die vor allem bei den Kindern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe. Da Kim und seine Frau wegen der Kinder früh auf den Beinen sein müssen, beenden wir den Abend gegen 22:00 Uhr. Zum guten Schluss erhalten wir noch einen Einladung für eine Stippvisite in Chicago. Wir bedanken uns, geben aber zu bedenken, dass wir gerade aus Osten kommend, unseren Rückweg noch nicht kennen und vermutlich auch eher auf einer südlichen Route zurückkehren werden. But, you never know.
Am folgenden Morgen geht es erwartungsvoll in Richtung "Wind Cave". Gewohnt früh auf den Beinen, schleichen wir mit unserem Gefährt zunächst durch dichten Nebel. Dann führt die schmale Schotterpiste in ein malerisches Tälchen mit lichtem Baumbestand und saftigem hohen Gras. Am Ausgang des Tälchens verschwinden die Bäume, die Prärie nimmt Besitz von der Landschaft, die Nebelschwaden werden von der ungebremst strahlenden Sonne aufgezehrt.
Und da sehen wir sie auch schon! Es ist keine gewaltige, aber für "Greenhorns" doch eindrucksvolle Bisonherde. Zwischen uns laufen die Drähte heiß. Ohne, dass ich viel sagen muss reicht mir Angelika die gewünschte Kamera sowie das notwendige Zubehör und schon kann die Pirsch beginnen. Sie ruft mir noch nach: "Geh nur nicht zu nahe ran, wer weiß wie die reagieren, wenn man ihnen zu sehr auf den Pelz rückt!" Doch die Warnung erreicht kaum noch mein Ohr. Fasziniert von den strammen kraftstrotzenden Körpern der Bisons, baue ich den Dreifuß auf wähle das stärkste Teleobjektiv und beginne mit Nahaufnahmen.
Mächtige Bullen, Kühe mit Neugeborenen, Jährlinge, alles wandert ruhig und friedlich grasend über die Wiese. Alle guten Ratschläge sind Schall und Rauch angesichts dieses Anblicks. Näher und näher taste ich mich an einige der größten Bullen heran. "Die mußt du ablichten, so eine Gelegenheit bekommst du während der gesamten Reise vielleicht nur ein einziges Mal", animiert mich eine innere Stimme.
Als einer der Bullen, fiedlich zwar, aber doch bestimmt Kurs auf mein Dreibein nimmt fährt mir ein leichter Schreck in die Glieder. Einen Augenblick lang werden meine Füße schwer wie Blei, dann erlange ich meine Fassung wieder und trete vorsichtig den Rückzug an. Ja, das lässt das Herzchen schneller schlagen, doch der Schreck sitzt nicht tief genug. Die Objekte meiner Begierde schreiten weiterhin vor der Kamera auf und ab, da bleibt wenig Zeit für Sentimentalitäten. Waren wir am frühen Morgen noch alleine, so füllt sich der schmale Feldweg allmählich mit immer mehr Besuchern. Die Bisonherde kratzt das kaum. Nur wenn der eine oder andere Besucher einmal den unsichtbaren Toleranzabstand unterschreitet, kommt es zu Unmutsäußerungen oder zu Scheinangriffen. Aber die Bisons scheinen um ihre Kraft zu wissen und verwenden wenig Energie darauf sich mit Besuchern anzulegen.
Während die Nächte schon recht kühl sein können wird es gegen Mittag fast schon ungemütlich warm. Während wir unsere Pullis oder Sweat Shirts abstreifen sind die zotteligen Gesellen gezwungen kühlere Gefilde aufzusuchen und so ziehen sie sich zunehmend von der Wiesenfläche in die angrenzenden lichten Wälder zurück. Wir folgen ihnen nun nicht mehr. Im offenen Grasland, kein Baum, kein Strauch, kein Van als Deckung, wollen wir nicht zum Objekt latenter Aggression werden. Mit diesen Eindrücken endet unser Aufenthalt in den Black Hills.
Devils Tower National Monument
Als wir den Black Hills Lebewohl sagen, kreisen unsere Gedanken bereits um die Wunderwelt des Yellowstone National Parks. Einige Meilen nördlich unseres direkten Weges liegt jedoch der Devils Tower, ein Monolith den ich in dem Film "Unheimliche Begegnung der dritten Art" erstmals zu Gesicht bekam. Später las ich auch einiges über diesen steinernen Turm und fand dessen Gestalt und Umfang so beeindruckend, dass ich mir den schon gerne einmal aus der Nähe anschauen würde. Angelika steht solchen Spontanausritten in unbekanntes Terrain, wegen der ständigen Übertreibungen amerikanischer Fremdenverkehrswerbung immer etwas skeptisch gegenüber. Da sie den Film jedoch auch kennt, geht der Daumen nach oben und so begeben wir uns auf den Weg nach Norden.
Dieses Mal wird unser "Mut zum Risiko" tatsächlich belohnt. Weithin sichtbar überragt der Devils Tower die rollenden Hügel Nordost-Wyomings. Hinter der Talaue des Belle Fourche River steigt das Gelände über die Sand- und Siltsteinklippen der Spearfish-Formation zunächst steil an. Mit dem Erreichen der darüber abgelagerten Gypsum Spring Formation wird der Geländeanstieg deutlich moderater. Zusammen bilden diese beiden Formationen einen kleinen Tafelberg aus, auf dem der Devils Tower thront und dies verleiht dem Monolithen dann ein noch wuchtigeres Aussehen als es ohnehin schon der Fall ist. Darüber hinaus erzeugt die Abfolge von hellgrüner Talaue, roten und weißen Sedimenten, dunkelgrünem Ponderosa-Kiefernwald, graubraunem Tower und schließlich tiefblauem, wolkenlosem Himmel wieder einmal ein prächtiges Farbenspiel. Leider gelingt es uns nicht diese wundervolle Komposition auch fotografisch einzufangen, weil wir heute einfach zu spät dran sind und die Sonne schon viel zu hoch am Himmel steht. Wenn das Mal kein Grund ist nochmal hier vorbeizuschauen.
Versorgt mit Informationsmaterial aus dem Besucherzentrum, lassen wir uns in gebührendem Abstand vom Devils Tower auf einer Wiese nieder und schauen ungläubig die steilen Wände hinauf. Einer Broschüre entnehmen wir, dass die Basis des steinernen Turms einen Durchmesser von gut 300 Metern erreicht und der Gipfel immerhin noch einen Durchmesser von etwa 90 Metern aufweist. Vertikal erhebt sich der Monolith etwa 280 m über seine mit Poderosakiefern gesäumte Basisfläche. Sein höchster Punkt liegt gut 1.500 m über Meereshöhe.


Der Devils Tower besteht aus vulkanischem Phonolithgestein, auch Klingstein genannt. Der Gesteinsblock wird aus einer Vielzahl, in der Regel fünf- und sechseckiger Gesteinssäulen aufgebaut. Die Säulen entstanden aufgrund von Schrumpfungsrissen innerhalb einer schon festen, jedoch weiter abkühlenden Gesteinsmasse.
Vom Fels kommen Stimmen, die man zunächst gar nicht zuordnen kann. Als wir jedoch längere Zeit die steilen Flanken absuchen, sind winzig klein einige Kletterer auf halber Höhe der Steilwand auszumachen. Jetzt erst wird so richtig deutlich, was für Ausmaße der Monolith als Ganzes hat, wie groß aber auch die einzelnen Steinsäulen ausfallen, denn die Kletterer finden in den Aussparungen zwischen den Säulen ausreichend Platz. Um den Blick vom Top des "Towers" beneide ich diese Wagemutigen sehr, doch die Strapazen, welche vor dem Gipfel liegen, möchte ich nicht auf mich nehmen. Von den indianischen Völkern der Region, unter ihnen die Lakota Sioux, die Cheyenne und die Kiowa werden die Kletterer überhaupt nicht gerne gesehen, weil ihnen dieser Ort heilig ist. Sie würden die ganze Kletterei am liebsten verbieten lassen, konnten sich damit aber bisher nicht durchsetzen. Immerhin verzichten mittlerweile viele Kletterer auf eine Besteigung im Monat Juni weil einige Indianerstämme zu dieser Jahreszeit durch entsprechende Zeremonien dem Berg huldigen. Erstaunlich ist auch die Konsequenz, mit der die Pflanzen jede Krume besiedeln, die ein bisschen Leben verspricht.
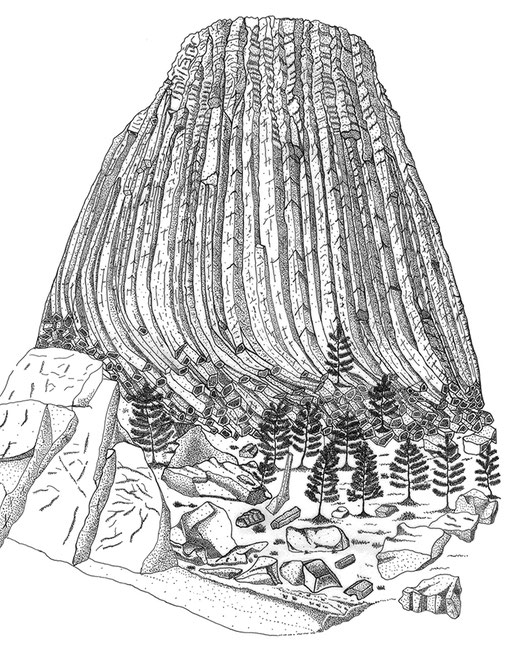
Wo Sämlinge der Ponderosakiefer auch nur die winzigste Nahrungsquelle aufspüren, setzen sie sich zwischen den fast senkrecht ansteigenden Polygonen fest und scheinen geradezu am Fels zu kleben, verdammt zu Zwergenwuchs oder frühem Tod. Schon in den Black Hills ist uns aufgefallen, dass die Ponderosa-Kiefer häufig nicht diesen dichten Wald, wie wir ihn von zuhause kennen sondern eher lichte Wälder ausbildet. Ein Ranger in den Black Hills erklärte uns dazu, dies hänge mit den gelegentlich auftretenden Waldbränden zusammen, die in den Schutzgebieten nur im Notfall gelöscht werden würden. Sofern die Bäume eine gewisse Größe erreicht hätten, seien die Ponderosa-Kiefern, auch Gelb-Kiefern genannt, dank einer überdurchschnittlich dicken Borke sehr feuerresistent. Bei gelegentlichen Bränden würden das Unterholz und damit sämtliche Sämlinge, Büsche und kleinwüchsigen Bäume vernichtet, die großen Solitäre jedoch verschont. Auf diese Weise bilde sich im Laufe der Jahrzehnte dann der lichte, aufgelockerte Hochwald aus, der an vielen Orten im Westen zu sehen ist.
Die Geologen sind sich nicht so ganz einig womit sie es beim Devils Tower eigentlich zu tun haben. Die einen gehen davon aus, dass es sich um den Rest eines abgetragenen Vulkans handelt. Andere vermuten dagegen, dass es sich um einen Schlot handelt, der die Erdoberfläche gar nicht erreicht hat sondern beim Aufstieg in den oberflächennahen Bodenschichten stecken geblieben ist.
Unstrittig ist jedenfalls, warum wir diesen Monolithen heute so aufregend herauspräpariert vorfinden. Dies hängt einmal mehr mit der unterschiedlichen Verwitterungsresistenz der Gesteine zusammen. Die Sedimentgesteine der Spearfish- und der Gypsum Spring Formation sowie der darüber abgelagerten und inzwischen längst fortgespülten Gesteine hatten bzw. haben den Kräften der Verwitterung einfach weniger entgegenzusetzen als der kompakte vulkanische Phonolith. Und so präparierten die Schwerkraft und sämtliche Spielarten des Wassers, insbesondere der Belle Fourche River einem Steinmetz gleich den Monolithen ganz langsam aus seinem Sedimentbett heraus.
Der Belle Fourche River trug die Sedimente im Umfeld des Devils Tower immer weiter ab, so dass der steinerne Turm nach und nach freigelegt wurde.

Weil das Phonolithgestein deutlich verwitterungsresistenter ist als die umliegenden Sedimentgesteine, blieb der vulkanische Kegelstumpf erhalten.
Nachdem wir den Berg aus der Ferne ausreichend gewürdigt haben, wollen wir ihn auch einmal aus der Nähe betrachten. Hierzu begeben wir uns auf den Tower Trail, der unmittelbar um den Fuß des Monolithen geführt ist und eine Länge von etwa 1,5 Kilometern aufweist. Zu beiden Seiten des Trails liegen versprengte Reste von herabgestürzten Säulen, darunter vereinzelte Riesen mit bis zu 4 Metern Durchmesser. Hoch über unsren Köpfen überall Abrisskanten, von denen aus die Stümpfe den Weg in die Tiefe antraten. Der Säulenfriedhof vermittelt nicht gerade ein Gefühl der Sicherheit. Immerhin gibt es aus den letzten Jahren keine Aufzeichnungen, die von einem Absturz berichten.
Der Tag ist jetzt schon weit fortgeschritten, die Sonne knallt vom Himmel, zwischen Kiefern, Büschen und Gesteinstrümmern weht kaum ein Lüftchen und so wird es auf der Sonnenseite des Monolithen richtig heiß. Die Kletterer, die wir aus der Ferne kaum erkennen konnten erscheinen auch vom Fuß des Turmes aus nicht wirklich groß, aber man kann doch das eine oder andere Detail erkennen. In schwindelnder Höhe schaukeln sie vor der riesigen Säulenwand Hin und Her, wirken aber überhaupt nicht angestrengt sondern genießen sichtlich ihren privilegierten Ausguck und lassen sich in dem Bestreben, den Gipfel zu erreichen, kaum von der Sonne beeindrucken. Dort oben wird sicherlich auch ein laues Lüftchen wehen, das die Mittagshitze etwas erträglicher macht. Mit lautem Gejohle grüßen die Kletterer die unter ihnen vorbeiziehenden Besucher und die grüßen erfreut zurück.
Uns wird es unterdessen auf der Sonnenseite zu heiß, wir führen nur einen begrenzten Wasservorrat mit und wenn wir weiter so schwitzen wird der bald aufgebraucht sein. An einem schattigen Plätzchen legen wir uns auf die Wiese, rasten ein wenig und nehmen im Liegen fotografierend die Steilwand ins Visier. Dann ziehen wir von einem Flecken zum nächsten, fotografieren die heruntergefallenen Steinsäulen, schief gewachsene Kiefern, die Abrißkanten und einige Vögel, die ebenfalls den Schatten aufgesucht haben, weil es ihnen auf der Südwestseite zu unangenehm geworden ist. Nach zwei Stunden erreichen wir endlich wieder unser rollendes Heim, machen uns frisch und füllen die Wasserreserven auf.
Weil ich Angelika nur eine Tag für den Devils Tower aus dem Kreuz leiern konnte, würde ich am liebsten gleich wieder losziehen, um den nächsten Trail zu begehen. Doch sie ist des Laufens überdrüssig und schlägt vor die Präriehundekolonie am Fuß des Tafelberges aufzusuchen, was wir schließlich auch tun.
Die Kolonie befindet sich unweit unseres Parkplatzes im Südosten des Devils Tower an der Hauptzufahrtstraße zum Monument und ist insofern überhaupt nicht zu verfehlen. Präriehunde trifft man im gesamten Westen des nordamerikanischen Kontinents von Südkanada bis Nordmexiko. Sie leben in Bauten, deren Grabgänge mehrere hundert Meter Länge erreichen können und spielen hierdurch eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie lockern den Boden auf, ermöglichen es dem Oberflächenwasser damit leichter in den Untergrund einzudringen und düngen mit eingeschleppten Gräsern und ihren Hinterlassenschaften den Boden, so dass insbesondere in Gebieten mit geringeren Niederschlagsraten das spärliche Nass besser verteilt wird und länger vorhält.
Präriehundkolonie am Fuß des Devil's Tower National Monuments.
Für die zahlreichen Besucher haben die Tiere noch einen ganz anderen Vorteil: Sie sind tagaktiv und können deshalb gewissermaßen zur besten Sendezeit live und kostenlos beobachtet werden. Ich weiß nicht wer zuerst da war, die Präriehunde oder die Straße. Jedenfalls haben sie auf beiden Seiten Quartier bezogen, was ihnen bei Tunneltiefen bis zu 5 Metern auch wenig Probleme bereiten dürfte, solange zumindest, wie sie die Unterführung und nicht die Straße benutzen. Vor der Kolonie sind mehr Besucher anzutreffen als oben auf dem Trail. Möglich dass es an der großen Hitze liegt, möglich aber auch, dass die Leute von hier aus mit einem kurzen Ausstieg aus dem klimatisierten Wohnmobil gewissermaßen alles auf einmal erledigen können. Für einen Schnappschuss fürs Familienalbum reicht es allemal und die Tierchen sind offenbar weitaus unterhaltsamer als totes Gestein.
Und so sitzen viele auf ihren Campingstühlen, ein kühles Getränk in Reichweite und beobachten das Familienleben der Präriehunde. Da die Kolonie nun mitten in der Sonne liegt, geht es den Nagern wie ihren neugierigen Beobachtern. Die wenigen, die offensichtlich der Hunger übermannt, treibt es nach oben an den gedeckten Tisch, der Rest bevorzugt Souterrain. Und weil es oben wegen der vielen Fressfeinde, wie Greifvögel, Klapperschlangen, Iltisse, Kojoten und Dachse zu gefährlich ist, werden grundsätzlich Wachposten aufgestellt, die meist auf einer erhöhten Position verharrend im Rundumblick die Umgebung absuchen, um bei der geringsten Gefahr ihren namengebenden Laut auszustoßen. Sofort verschwinden dann alle Koloniebewohner schlagartig in einem der Eingänge und lassen sich bis auf weiteres nicht mehr sehen. Allerdings fragt man sich auch, wo Fressfeinde bei diesem Rummel hier eigentlich herkommen sollen.
Wenn die Präriehunde so mit ihren pummeligen Körpern im Gras sitzen, könnte man sie in den Arm nehmen und kuscheln, doch die Broschüre der Parkverwaltung warnt ausdrücklich davor den Kameraden zu nahe zu kommen, weil diese kräftig zubeißen können. Und so wurde schon manche ohnehin verbotene Fütterung auf schnellerem Wege bestraft als es sich die gutmeinenden Besucher hatten vorstellen können.
Während wir also ständig den Herrschaften zusehen, wie die sich den Bauch vollschlagen, fällt mir ein, dass wir abgesehen von einem gediegenen Frühstück auch noch nicht allzuviel zu uns genommen haben und so nehmen wir unseren inzwischen lieb gewonnenen Coleman Stove wieder einmal in Betrieb und bereiten uns aus übrig gebliebenen Spaghetti und anderen Resten ein sättigendes Abendessen.
Auf unserem Weg nach Westen bietet sich nun noch ein weiterer Abstecher an. Unweit des Devils Tower, es sind gerade einmal 230 Meilen oder läppische 370 km liegt im Süden Montanas, in einem Reservat der Crow-Indianer das Little Bighorn Battlefield National Monument. Die Gedenkstätte soll an die Schlacht vom 25. Juni 1876 erinnern, in der das siebte US-amerikanische Kavallerieregiment (das sind die Berittenen) unter General George A. Custer von Indianern der Lakota-Sioux, Arapaho und Cheyenne unter ihren Führern Sitting Bull und Crazy Horse am Little Bighorn River vernichtend geschlagen wurde.
Nach einem kurzen Besuch im Visitor Center erkunden wir das Gelände zunächst auf eigene Faust und versuchen uns auf unserem Weg über die fast baumlosen grünen Hügel anhand der Hinweistafeln einen Überblick über die Vorgänge an jenem Tag zu verschaffen, was jedoch nur bedingt gelingt. Und so schließen wir uns später der Führung eines Crow-Indianers an, der die Abläufe noch einmal zusammenfast. Sehr plastisch schildert er, wo Custer mit seinen Männern stand als er von seinen indianischen Vorfahren angegriffen wurde, wie sich die Soldaten danach über das Gelände bewegten, wie die indianischen Angreifer darauf reagierten, der Armee schließlich den Rückzugsweg abschnitten und ihre Niederlage besiegelte. Der Mann zeigt Talent weil er diese ganzen Abläufe so plastisch schildert, dass man gelegentlich meinen könnte, die Reiterhorden würden soeben über die rollenden Hügel donnern und übereinander herfallen. Kritisch nimmt er später auch Stellung zur heutigen Situation der Indianer, verweist auf manche Vorurteile, die immer noch in Teilen der Gesellschaft gegenüber den Ureinwohnern, den First Nations des nordamerikanischen Kontinents bestehen und hinterlässt, als er seinen Vortrag beendet hat eine nachdenkliche Zuhörerschar. Das traurige ist, sagt er, dass immer jene zu solchen Orten "unrühmlicher" amerikanischer Geschichte fahren, die sich des begangenen Unrechts bewusst sind, diejenigen aber, die sich diesen Tatsachen eigentlich stellen müssten, kommen selten oder nie. Da sind die Amerikaner allerdings nicht alleine.
Sommer im Yellowstone National Park
Vom Custer Battle Field kommend, fahren wir nun in Richtung Yellowstone National Park. Die bequeme Route hätte über die Interstate 90 bis Livingston und von hier aus über die Straße 89 zum Nordeingang des Parks bei Gardiner geführt. Da wir schon mehr als genug Interstatekilometer auf dem Buckel haben, entscheiden wir uns für die landschaftlich vielversprechendere Variante.
Auf engen Straßen, die dem ständigen Auf und Ab der nur spärlich bewachsenen, rollenden Hügel folgen, geht es nur langsam voran. Weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Auf der Karte verlieren wir allmählich den Überblick, gelangen schließlich auf eine Schotterpiste und wissen nicht mehr so recht wo wir uns eigentlich befinden. Zwar steht die Sonne am Himmel, so dass wir grob die Nordrichtung ausmachen können. Weil aber der genaue Verlauf der Straße nur über kurze Strecken zu verfolgen ist, wissen wir nie so recht, ob wir tendenziell in Richtung Südwesten auf unser Ziel zu fahren oder am Ende ganz woanders herauskommen. Und so habe ich am Nachmittag reichlich Zeit, den gefassten Beschluss zu bereuen. Hier liegt wirklich der Hund begraben. Ein eingefleischter Städter würde wahrscheinlich verrückt, wenn er ein halbes Jahr in dieser Einöde verbringen müsste. Was hilft es, irgendwie müssen wir eine in der Karte eingetragene Straße erreichen und schauen, wie weit wir abgedriftet sind. Als die Schotterpiste eine Hochfläche erreicht und endlich einmal in eine langgezogene Gerade übergeht halten wir an, schauen uns um und prüfen nochmals genau die Karte, ohne danach wirklich schlauer zu sein. Doch dann steigt am Horizont Staub auf und als wir näher hinsehen erkennen wir, dass sich uns ein Pickup nähert. Ein freundlicher älterer Herr steigt aus dem Fahrzeug und fragt in kaum verständlichem Englisch, was zur Hölle wir in dieser Einöde suchen. Wir erklären ihm unsere Misere und er zeigt uns auf der Karte wo wir uns in etwa befinden. Tatsächlich sind wir nur noch 2 Meilen von der Asphaltpiste entfernt. Wenn ich den Mann aus Wyoming richtig verstanden habe, befinden wir uns auf dem Anwesen einer riesigen Rinderfarm. Glücklich die Asphaltpiste wiedergefunden zu haben verabschieden wir uns und machen uns auf den Weg nach Cody.
In Cody stellen wir unser rollendes Heim auf einem Parkplatz in der Nähe des Buffalo Bill Museums ab. Hier herrscht ein reges Treiben. An einer Stelle des Platzes steht eine ganze Reihe von Wohnmobilen, vor diesen sind Tische und Campingstühle aufgebaut und man hat nicht den Eindruck, dass die Leute hier nur eine kurze Rast machen möchten. Schnell kommen wir mit einigen Campern ins Gespräch und erfahren nach dem Austausch der üblichen Nettigkeiten, dass es keinen Sinn macht heute noch in den Yellowstone Park einzufahren. Erfahrungsgemäß bekomme man im Sommer zu dieser Tageszeit keinen Campingplatz mehr und müsse in diesem Fall den Park wieder verlassen, was gleichbedeutend sei mit etlichen Zehnerkilometern unnützer Fahrerei. Wir wollten es ohnehin gemütlich angehen lassen und so stellt Angelika unser Fahrzeug kurzerhand zu den bereits abgestellten Campern. Da wir die Einkaufsmöglichkeiten im Park nicht einschätzen können und auch noch keine genaue Vorstellung haben, wie lange der Aufenthalt dauern soll, füllen wir in Cody erst einmal unsere Speisekammer ordentlich auf. Dann werfen wir einen Blick in das Buffalo Bill Museum und lassen den Abend ruhig ausklingen.
Die Nacht war recht kühl. Als wir am Morgen aufwachen, ist um uns herum noch alles still. Um nicht zu viel Lärm zu machen verstauen wir nur die lose im Fahrzeug liegenden Utensilien, räumen unser Bett auf, schlürfen dann noch einen heißen Kaffee und schleichen uns von der Parkfläche. Erst steigt die Straße nur moderat an, aber dann geht es beständig nach oben. Das vor Cody noch hügelige Gelände bildet nun auf beiden Seiten Bergketten aus, deren weiter entfernt liegende schneebedeckte Gipfel zum Teil schon deutlich über 2.500 m Höhe erreichen dürften. Endlich taucht der Eingang des Parks vor uns auf. Wir entrichten unseren Obolus, erhalten eine Übersichtskarte, einige kurze Hinweise und Ratschläge sowie eine kleine Broschüre und los geht es.
Wie wir der Karte entnehmen können, führen insgesamt 5 Hauptzufahrtswege zum Yellowstone National Park. Zwei im Norden, einer im Westen, einer im Süden und den östlichen, auf dem wir gerade in den Park eingefahren sind. So wie früher einmal alle Wege nach Rom führten, bringen die genannten Zufahrtswege im Yellowstone den Besucher früher oder später auf eine Ringstraße, die die Form einer 8 oder eines doppelten Rings beschreibt. Dieser Doppelring erschließt mit einigen Abzweigen den größten Teil der im Yellowstone Park per Fahrzeug zu entdeckenden Sehenswürdigkeiten. Die überwiegende Zahl der Geyserfelder liegt entlang des südlichen Rings. Wir wollen uns während unseres Sommeraufenthaltes auf diesen konzentrieren und alle Sehenswürdigkeiten nördlich davon für unsere bereits jetzt geplante herbstliche Rückkehr aufbewahren.
Auf unserem Weg in den Park steigt die Straße bis zum 2600 m hoch gelegenen Sylvan Pass weiter leicht an, um danach ebenso moderat in den Park hinein abzufallen. Nach etwa 15 Kilometern Fahrt beginnt sich das Tal weit zu öffnen und zu unserer linken breitet sich der Yellowstone Lake aus. An einer Picnic Area direkt am Seeufer halten wir an, bereiten das Frühstück und genießen die Aussicht weit in den Park hinein. Der Seewasserspiegel liegt immer noch in ca. 2.350 m Höhe. Das Seewasser ist eiskalt, soll angeblich trotz der heißen Quellen ganzjährig nie mehr als 5 Grad Celsius erreichen. Ein leichter Wind kräuselt die Wasseroberfläche, doch die Sonne blinzelt zwischen den Wolken hindurch und so werden wir trotz der Höhe mit erträglichen Temperaturen im Park willkommen geheißen. Der See ist während unserer Stippvisite total leer, kein Ausflugsboot, wie bei uns in solchen Fällen üblich, selbst Kanus suchen wir vergebens.
Nach dem Frühstück sollten wir nun eigentlich zuerst in eines der Besucherzentren fahren, um uns eine bessere Orientierung zu verschaffen, aber wir sind viel zu neugierig und wollen erst einmal etwas sehen. Und so folgen wir der Straße in nordwestliche Richtung, passieren das weite Grasland des Hayden Valleys und gelangen eher zufällig zum Grand Canyon of the Yellowstone. Hier hat sich der Yellowstone Fluss tief in das Gestein eingeschnitten und hier wird auch deutlich wie der Nationalpark zu seinem Namen kommt. Durch hydrothermale Aktivität nämlich hat ein großer Teil des Gesteins, welches die Wände der Schlucht aufbaut eine leuchtend hellgelbe Farbe angenommen die namensgebend wurde. Neben diesen dominierenden Gelbtönen trifft man auch auf rosarot, violettrot oder rotbraun eingefärbte Canyonwände. Zwischen diesen stürzt das eigentlich dunkelgrüne jedoch häufig weiß schäumende Wasser des Yellowstone Rivers talwärts. Kommt dann an sonnigen Tagen noch ein tiefblauer Himmel hinzu oder strahlt die Sonne von einem leicht bewölkten Himmel mit wechselnder Intensität auf die Canyonwände ein, dann entsteht ein atemberaubendes und im Tagesverlauf ständig wechselndes Farbenspiel von unglaublicher Schönheit und Eleganz.
An zwei Punkten haben sich Wasserfälle, der Upper und der Lower Fall des Yellowstone Rivers ausgebildet. Während wir oberhalb der Schlucht zwischen den Wasserfällen hin und herwandern, um im Wechselspiel der Sonne möglichst gute Standorte für einige Fotosessions zu finden, haben sich auf einer steinernen Begrenzungsmauer mehrere Rabenvögel aufgebaut. Zunächst lichten wir diese aus einiger Entfernung ab und versuchen uns dann näher und näher heranzutasten um schließlich festzustellen, dass die Biester überhaupt nicht scheu sind. Eigentlich hätten wir uns die ganze Pirsch sparen können. Wie manch andere Tierart haben sich die munteren Gesellen längst auf die seit Jahrzehnten ansteigenden Besucherströme eingestellt und erwarten eigentlich nur eines, dass sie gefüttert werden. Da darf dann der üblicherweise einzuhaltende Sicherheitsabstand gerne auch einmal unterschritten werden, zumal die Gesellen auch zu wissen scheinen, dass sie den ungelenk agierenden Touristen mit ein paar Flügelschlägen jederzeit rasch entkommen können. Mit ihrem gar so drolligen Blick und lustigen Hüpfbewegungen kommen Sie vermutlich nicht selten zum Ziel und können sich manchen Ausflug in die Wildnis ersparen.
Im Canyon-Dorf verschaffen wir uns dann doch noch einen ersten Überblick über die Sehenswürdigkeiten im Park. Dort erkennen wir auch sehr schnell, dass unser Einkauf in Cody nicht zwingend notwendig gewesen wäre, die Einrichtungen im Park sind so gut ausgestattet, dass hier nun wirklich niemand Hunger leiden muss.
Wie wir nun erfahren, umfasst der Yellowstone-Park eine Gesamtfläche von annähernd 9000 km². Somit ist er fast halb so groß wie unser heimatliches Bundesland Hessen mit ca. 21.000 km². Und ein weiterer Vergleich: Die Schweiz erreicht lediglich etwa viereinhalb Mal, Österreich nur 9 Mal die Größe des Yellowstone Parks. Der Park liegt etwa auf dem 44. Breitengrad, das entspräche in Europa zum Beispiel dem italienischen Badeort Rimini. Während im Yellowstone die Temperaturen im Winter bis -30 Grad und tiefer sinken können, ist das in Rimini eher nicht zu erwarten. In Nord-Süd-Richtung erreicht das Schutzgebiet immerhin eine Ausdehnung von rund 100 km und in Ost-West-Richtung eine von knapp 90 km. Dem entsprechend ist es bei den wenigen Tagen, die wir hier verbringen können unmöglich auch nur annähernd alle Sehenswürdigkeiten anzuschauen. In den Besucherzentren wird man von der Fülle an Informationen fast erschlagen. Schautafeln, Filme, Bildvorträge, kleine Ausstellungen, Broschüren und Bücher in allen nur erdenklichen Preislagen und Variationen, Vorträge von Rangern in der freien Natur, spezielle Kinder- und Abendprogramme, da bleiben nur wenige Wünsche offen. Die eigenen Ausflüge mit interessant erscheinenden Führungen zu verbinden ist an manchen Tagen gar nicht so einfach, denn häufig trifft man im Park auf irgendwelche Tiere oder aufregende Naturphänomene, die einem schon Mal die Zeit vergessen lassen, so dass man dann u. U. mitten in der Natur unter Termindruck gerät, was während des Urlaubs eigentlich nicht der Fall sein sollte. Obwohl wir schon zuhause zahllose Reisebücher, Bildbände und Reportagen über den nordamerikanischen Kontinent gelesen bzw. gesehen hatten, werden wir von der Höhenlage des Yellowstone-Plateaus doch etwas überrascht. Die Straßen liegen eigentlich durchweg zwischen etwa 2.400 und, nimmt man die eine oder andere Schotterpiste dazu annähernd 3.000 m und das bedeutet, dass man auch mitten im Sommer immer einmal mit einem Kälteeinbruch und auch mit Schneefall rechnen muss.
Obwohl uns die Camper in Cody eigentlich schon auf Engpässe bei den Übernachtungsmöglichkeiten hingewiesen hatten, schenken wir dieser Frage nach einigen Tagen im Park kaum noch Beachtung. Von Neugier getrieben rückt der Tagesordnungspunkt Stellplatzsuche ständig weiter nach hinten, bis wir uns irgendwann erst Nachmittags bequemen einen geeigneten Campingplatz zu suchen, dabei grandios scheitern und nur mit viel Mühe vermeiden können aus dem Park herausfahren zu müssen. Das diszipliniert und von diesem Tag an steuern wir unsere weiteren Ausflugsziele immer erst an, nachdem wir schon am Morgen in der Nähe einen Campingplatz bezogen haben. Doch auch diese Vorgehensweise führt nicht immer sofort zum Ziel. Manchmal wollen wir es besonders gut machen, sind aber noch zu früh am vorgesehenen Übernachtungsort, die Plätze sind noch gar nicht geräumt und so müssen wir uns gedulden bis wir Besitz ergreifen und unseren Tagesausflug antreten können. Einmal konnten wir nur deshalb vor Ort bleiben, weil einige Freaks, die hier mit einem vergleichsweise kleinen VW-Bus unterwegs waren uns anboten den Platz mit ihnen zu teilen.
Über die Entstehungsgeschichte des Yellowstone Parks haben wir inzwischen viele interessante Details in Erfahrung bringen können. Geologen, die das Schutzgebiet eingehend untersucht haben, gehen davon aus, dass dieses über einem sogenannten Hot Spot, also einem heißen Fleck liegt. Hot Spots sind an verschiedenen Punkten der Erde auftretende, riesige, stationäre Magmenkammern, über die die obere Erdkruste wie ein Fließband unmerklich langsam hinweg gleitet und an denen durch Hitze verflüssigtes Gestein (Magma) aus dem tieferen Erdinnern bis dicht unter die Erdoberfläche aufsteigt bzw. in Form vulkanischer Tätigkeit bis an die Oberfläche durchbricht. Umgangssprachlich könnte man es so formulieren, dass das Fließband Erdkruste von Zeit zu Zeit ein Loch in den Frack gebrannt bekommt. Ein anderer Hot Spot ist übrigens die Hawaii-Inselgruppe. Während die Lava auf Hawaii fast kontinuierlich und friedlich ihren Weg nach oben sucht und findet, wechseln im Yellowstone-Gebiet inaktive Zeiten mit einigen wenigen, dann aber extrem heftigen Ausbrüchen ab.
Die Geologen vermuten, dass dies u. a. mit der dünneren ozeanischen Kruste und Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Gesteine zusammenhängt. Stark vereinfacht ausgedrückt setzt die mächtigere kontinentale Kruste im Yellowstone-Gebiet der aufsteigenden Lava erheblich mehr Wiederstand entgegen. Hierdurch staut sich die in der Magmenkammer angesammelte Energie unter den oberflächennahen Schichten auf, wölbt diese einem Uhrglas gleich nach oben und spannt sie wie einen Bogen bis die starren Deckschichten spröde und rissig werden, so dass sich die mit reichlich Gasen angereicherte Magmenkammer irgendwann fast schlagartig entleeren kann.
Der Hot Spot, die ortsfeste, riesige Magmenkammer unter der Kruste ist also der Motor, der im Yellowstone Gebiet all die herausragenden Naturschauspiele überhaupt erst möglich macht, der sie lange Zeit am Leben erhält und eines schönen Tages schlagartig vernichtet, um sie danach, bedingt durch die Wanderung der Krustenplatte einige Zehnerkilometer weiter neu entstehen zu lassen. Der nächste Ausbruch wird dann wohl im Grenzgebiet zu Montana stattfinden. Wenn die Ausbruchskatastrophe erst einmal überstanden ist, dürfen sich dann zwei Bundesstaaten an diesen Spielarten der Natur erfreuen.
Die Yellowstone-Caldera ist ein Supervulkan. Ein Ausbruch dieser Größenordnung stellt den Ausbruch des Mt. St. Hellens bei weitem in den Schatten. Mehr oder
weniger gut dokumentiert sind wenigstens drei größere Ausbrüche, die im Parkgebiet oder unweit hiervon vor 2,1 Millionen (Huckleberry-Ridge-Ausbruch), 1,3 Millionen (Mesa-Falls-Ausbruch) und
0,64 Millionen Jahren (Lava-Creek-Ausbruch) stattfanden. Könnte man diese Ausbruchsserie eins zu eins in die Zukunft fortschreiben, wäre ein weiterer Ausbruch demnächst fällig. Aber einige
10.000 Jahre hin oder her sind in geologischen Zeiträumen gedacht gar nichts.
Auch wenn dies an der Oberfläche nicht erkennbar ist, wurden inzwischen weitere Kalderenfragmente bis nach Nordnevada nachgewiesen, die das Wirken des Yellowstone
Hot Spots über viele Millionen Jahre belegen.
Die Folgen des vorerst letzten Ausbruchs vor etwa 640.000 Jahren müssen verheerend gewesen sein. Nachdem der Druck aus dem „Topf“ war, bildete sich die aktuelle Caldera aus. Da es im Yellowstone Park selbst insgesamt zwei Ausbrüche gab, überlagern sich die beiden Calderen. Dies als Laie zu erkennen ist allerdings schwierig. Denn die jüngste Caldera zerstörte einen Gutteil der älteren. Wo diese aber erhalten blieb, wurde sie mit Auswurfprodukten des jüngsten Ausbruchs bombardiert, teils mit Laven geflutet und durch die Verwitterung mit Sedimenten also Ablagerungsprodukten aus den umliegenden Bergen aufgefüllt.
Die letzte Eruption verwüstete die Landschaft im Umkreis von 250 km und verdunkelte weltweit den Himmel für mehrere Jahre. Ein Ereignis dieser
Größenordnung hätte weltweit verheerende Auswirkungen, alles Leben auslöschen könnte sie aber nicht, sonst wäre das bei den letzten beiden Eruptionen bereits geschehen.
Die vorletzte Eruption muss übrigens noch größere Ausmaße gehabt haben. Die Kaldera des letzten Ausbruchs ist ungefähr 40 km lang und 25 km breit
und nimmt rund ein Viertel des gesamten Nationalparks ein. Noch innerhalb dieser liegen auch die nördlichen Teile des Yellowstone Lake. Der Caldera bzw. der unter ihr weiterhin vorhandenen
Restwärme verdanken wir den größten Teil der heute im Yellowstone National Park zu besichtigenden hydrothermalen Aktivitäten.
Ausbildung und Aufstieg der Magmakammer: Unter dem heutigen Yellowstone-Gebiet formiert sich vor ca. 0,65 Millionen Jahren erneut eine Magmakammer, die bereits vor 2,1 und 1,3 Millionen Jahren zu zwei Vulkanausbrüchen westlich der jetzigen Position geführt hat. Die Magmakammer hebt das spröde Deckgebirge ganz langsam immer weiter an, so dass dieses sich uhrglasförmig aufwölbt und erste Störungen im Gesteinsverband auftreten. Diese nehmen nach Anzahl und Ausdehnung immer weiter zu.
Entleerung der Magmakammer: Irgendwann ist der in der Magmakammer aufgebaute Druck so groß und das darüber befindliche Deckgebirge derart geschwächt, dass es entlang der Störungslinien zu einem weiteren Vulkanausbruch kommt.

Mit der sich entleerenden Magmakammer wird nun sukzessive Raum geschaffen, in den die Schollen des Deckgebirges nach und nach einbrechen.
Schließlich füllen vulkanische Auswurfprodukte und nachströmende Laven die Störungszonen und die entstandenen oberirdischen Senken auf. In den folgenden hunderttausend Jahren ebnen die
Verwitterungsprodukte aus den umliegenden Bergen die Yellowstone-Caldera weiter ein.
Die verschiedenen Geyserbecken liegen weit überwiegend an den Rändern und im Zentrum der Caldera. Im Gefolge des mit dieser hydrothermalen Aktivität verbundenen
milderen Mikroklimas hat sich eine reiche Tier- und Pflanzenwelt ausgebildet.
Da der Yellowstone National Park trotz seiner relativ abgeschiedenen Lage zu den beliebtesten Reisezielen im amerikanischen Westen zählt, ist gerade im Sommer an
vielen Tagen reichlich Betrieb und auch bei noch so umsichtiger Planung wird der Sommerbesucher dem nicht vollständig entkommen können. Die lohnendsten Ziele sind naturgemäß am besten erschlossen
und deshalb auch von jedem zu erreichen. Es ist nachvollziehbar, dass der Durchschnittstourist, dessen Lebensrhythmus das ganze Jahr über vom Wecker dominiert wird, im Urlaub gerne einmal
ausschlafen möchte. Anschließend soll dann natürlich ein ordentliches Frühstück, wenn möglich in gemütlicher Runde folgen und nächtigt man gar in einer der festen Unterkünfte, so kann sich die
morgendliche Vorbereitung auf die Herausforderungen des Tages richtig in die Länge ziehen. Und so strömen die Massen häufig erst zwischen 09:00 und 10:00 Uhr zu den touristischen Attraktionen.
Will man dem Rummel also etwas aus dem Wege gehen, gibt es keine bessere Strategie, als früh aufzustehen, ein kurzes Frühstück einzulegen und sich auf den Weg zu machen.
Der sprichwörtliche frühe Vogel kann die besuchten Naturschauspiele nicht nur ruhiger genießen, auch die Fotosessions fallen deutlich entspannter aus. Am frühen
Morgen stehen die besten Aufnahmepositionen zur Verfügung, niemand läuft ständig vor die Linse, die Motive wirken ohne Menschenmassen einfach attraktiver und die morgendliche Sonne wirft ein
unvergleichlich schöneres Spiel von Licht und Schatten über die Landschaft als dies in den Mittagsstunden jemals der Fall sein könnte. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit auf Wild zu
treffen unter den gegebenen Umständen ebenfalls deutlich höher. Das ausgiebige Frühstück kann man bei Bedarf zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, wenn sich die entsprechenden Einrichtungen geleert
haben, entspannt nachholen.
Eine weitere Strategie dem Rummel aus dem Wege zu gehen ist es einen oder mehrere der zahlreichen Wanderwege aufzusuchen, die über hunderte von Kilometern das
Hinterland (back country) erschließen. Die Wanderwege haben unterschiedlichste Längen und Schwierigkeitsgrade, so ist gewährleistet, dass für jede Leistungs- und Altersklasse etwas dabei ist.
Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass die Wahrscheinlichkeit entlang dieser Trails Wildtiere beobachten zu können ungleich höher ist als im Umfeld von Old Faithful oder Canyon Village. Davon
abgesehen ermöglicht der eine oder andere Wanderpfad an so manchem Aussichtspunkt einen fantastischen Ausblick ins Hinterland und einige Attraktionen, wie zum Beispiel die petrifizierten, also
versteinerten Bäume sind teils nur über entsprechende Trails zu erreichen. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, vor längeren Wanderungen nicht zurückschreckt und bereit ist auch einmal eine weniger
komode Schlafgelegenheit anzunehmen, kann auch auf einem der Hinterlandcampingplätze (back country) nächtigen.
Unser anfänglich gut durchorganisiertes Besuchsprogramm ist inzwischen auch etwas unter die Räder gekommen. Zwischen Norris Geyser Basin, Canyon Village und Hayden
Valley haben wir uns richtiggehend festgebissen und kommen nicht so recht vom Fleck. An manchen Nachmittagen strahlt die Sonne so kräftig vom Himmel, dass wir beschließen nach einigen kühleren
Tagen einfach Mal Sonne zu tanken. Und so legen wir uns auf dem Campingplatz vor unserem Van auf eine Decke und lassen das Himmelsgestirn unsere Gesichtsbräune aufpolieren, beobachten
Chipmunks, entnehmen unseren neu erworbenen Büchlein das eine oder andere lohnende Ziel, ergänzen unsere Tagebucheinträge und prüfen die Haushaltskasse. An einem anderen Tag fahren wir zunächst
etwas ziellos durch die Gegend, werden beim Passieren des Hayden Valleys auf einen kleine Gruppe Bisons aufmerksam und laufen weit in die offene Graslandschaft hinein, um die Gruppe endlich zu
erreichen und einige schöne Aufnahmen machen zu können. Später sehen wir einige Wapitis, die sich allerdings rasch in dem offenen Gelände absetzen und einen Coyoten, der allein auf weiter Flur
über die Ebene streift. An den Parkplätzen treffen wir immer wieder auf Streifenhörnchen, die sich hier, angelockt vermutlich von den zahlreichen Besuchern den einen oder anderen Leckerbissen
erhoffen. Nur von Bären ist weit und breit nichts zu sehen. Dazu müssten wir uns vermutlich in die abgelegeneren Gebiete im Nordwesten begeben.
In einer der zahlreichen Broschüren stoße ich zufällig auf eine Handlungsanweisung für den Fall, dass tatsächlich einmal ein Bär unmittelbar vor uns auftauchen
sollte. Da steht dann sinngemäß etwa, man solle auf keinen Fall Furcht zeigen und dem Bär den ersten Schritt überlassen, meist würde er dann das Feld räumen. Sollte der Bär näher kommen, um dich
neugierig zu beschnuppern und zu prüfen woran er ist, sollte man in jedem Fall weiter Ruhe bewahren. Das würde ich mir zu gerne Mal live beim Autor ansehen! Selbst wenn sich der Bär dann
entschließen sollte dir eine zu watschen solltest du nicht weglaufen (Das weckt seinen Jagdinstinkt!). Vielmehr solltest du dich möglichst auf den Bauch fallen lassen, die Hände über dem Nacken
verschränken und dich tot stellen. Wenn du am Boden liegend weiterhin vom Bären attackiert werden solltest, schreie nicht und zeige keine Gegenwehr, der Bär möchte nur etwas spielen (Als Jogger
habe ich da schon bei Hunden keine guten Erfahrungen gemacht!) Wenn er dich beim Spielen kratzt oder beißt bleib ruhig, sonst findet er Gefallen daran weiter zu spielen. Wenn du dieses alles
beherzigst wird der Bär sicher bald die Lust an dem Spiel verlieren und seines Weges gehen. Müssen wir also wirklich unbedingt einen Bären sehen? Ja! Sollte das in freier Natur sein? Nein! Vom
Auto aus reicht vollkommen. Der Mut auszusteigen kommt dann schon von selbst und der dürfte umso größer sein je kleiner der Bär ist und je scheuer dieser sich gebärdet. Und sollte aus Scheu
Neugier werden greife ich gerne auf unser rollendes Heim zurück.
Nach den sonnigen Tagen trübt sich der Himmel etwas ein, dem entsprechend sinken die Temperaturen und so sind wir gefordert unsere ganz persönliche Wohlfühltemperatur durch muskuläre Arbeit aufrechtzuerhalten. Also bietet es sich an weiterzuziehen und unserem anfänglich so ambitionierten Besuchsprogramm neues Leben einzuhauchen. Die von uns gewählte Sommerroute über den südlichen Ring gibt nun auch die Sehenswürdigkeiten der nächsten Tage vor. Dem Norris Geyser Basin starten wir nur einen kurzen Besuch ab, orientieren uns dann nach Süden und pendeln entlang der Südwestseite der südlichen Ringstraße zwischen Madison und West Thumb und damit zwischen den diversen Geyser Basins, die die weltgrößte Ansammlung hydrothermaler Aktivität darstellen.
Jahrzehntelange Untersuchungen im Yellowstone Gebiet lassen erkennen, dass die aus den umliegenden Bergketten der Caldera zulaufenden
Oberflächen- und Grundwässer über Störungsbahnen an den äußeren Rändern der Caldera in den tieferen Untergrund gelangen und von dort aus in Richtung des Calderazentrums wandern. Dieses Model
ist allerdings nur eine grobe Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse, um die Vorgänge erst einmal prinzipiell zu verstehen. Tatsächlich befinden sich die Geyser Basins an den
unterschiedlichsten Stellen, also auch am Rand der Caldera und die hydrothermalen Variationen sind so vielgestaltig und über die Jahre auch deutlichen Änderungen unterworfen, dass es noch vieler
Forschungsarbeit bedarf, um die Zusammenhänge weiter aufzuklären.
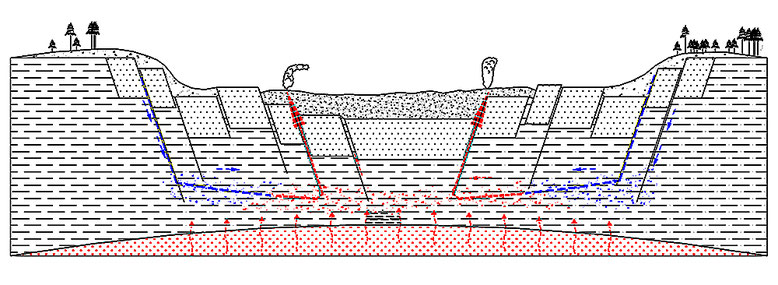
Hydrothermale Aktivitäten im Yellowstone National Park. Das an den Rändern der Caldera versickernde Oberflächenwasser wird im Untergrund erhitzt und
gelangt dann im Zentrum des Parks in Form unterschiedlichster hydrothermaler Aktivitäten wieder nach oben.
Die Wässer werden auf ihrem Weg durch den Untergrund weit über den Siedepunkt hinaus erhitzt. Im Yellowstone Gebiet siedet das Wasser
an der Erdoberfläche bei etwa 93 Grad Celsius.
Weil die Tiefenwässer jedoch unter Druck stehen, erreichen sie oft Temperaturen zwischen 150 und 200 Grad Celsius und beginnen dennoch nicht zu sieden. Durch die hohen Temperaturen werden auch im Untergrund vorhandene Mineralien, insbesondere Kalk gelöst. Häufig begegnet man im Yellowstone Gebiet dem Begriff Geyser Basin. Als solches bezeichnet man ein Gebiet mit heißen Quellen, in dem Geysire anzutreffen sind. Besucht man eines der vielen Geyser Basins so fallen sofort die allgegenwärtigen hölzernen Laufstege auf, die den Besucher sicher über den fragilen Untergrund geleiten und doch nahe genug an das Objekt der Begierde heranführen, um Fotoaufnahmen zu ermöglichen und einen ausreichenden Einblick zu gewährleisten. Nur bei kühler oder feuchtkühler Witterung ist es manchmal etwas schwierig das eine oder andere Pool tatsächlich zu Gesicht zu bekommen, weil die Dampfschwaden dann weniger rasch aufsteigen sondern sich in Bodennähe ausbreiten oder mit tiefstehenden Nebelbänken mischen und den heißen Quellen eine Tarnkappe aufsetzen.

Wo die Wässer nun über definierte Kanäle nach oben steigen und auf eine oberflächennahe und geysergeeignete Untergrundstruktur treffen, das muss ein im weitesten Sinne syphon- oder knieförmig gestaltetes Wasserleitsystem sein, können sie als Geysire mit mehr oder weniger hohen Dampf-Wasserfontainen austreten. Die Geysire sind also heiße Quellen, die mehr oder weniger periodisch ihr Wasser springquellenartig auswerfen. An der Erdoberfläche bilden viele Aufstiegskanäle einen trichterförmigen Mund aus in dem sich das Wasser sammelt. Bei entsprechender Mineralisation bilden sich herrlich anzuschauende blaugrüne bis gelbgrüne Pools aus.
Die ebenfalls anzutreffenden heißen Quellen unterscheiden sich dadurch, dass das Thermalwasser aus diesen gleichförmig und kontinuierlich unmittelbar über der Geländeoberfläche abfließt, sofern die Wasserzufuhr ausreicht. Bei geeignetem Temperaturgradienten können sich am Rande dieser heißen Quellen mikroskopisch kleine, einzellige und koloniebildende Pflanzen, die Cyanobakterien ansiedeln, deren unterschiedliche Arten unterschiedliche Temperaturtoleranzen und Farben aufweisen. An der Farbe des Algensaums eines Pools kann man ablesen, welche Temperaturen das Wasser in diesem Bereich hat. Leuchtend gelbe Farben etwa deuten auf Temperaturen um 70 Grad Celsius hin, ein leuchtendes Orange signalisiert 60 bis 65 Grad Celsius, dunkelbraune Algenbänder entsprechen Temperaturen zwischen 55 und 60 Grad Celsius und grüne Algenkolonien lieben etwa 50 Grad heißes Wasser. Mit vielen heißen Quellen untrennbar verbunden sind auch die meist weiß bis weißgrau, gelegentlich aber auch farbenprächtig ausgebildeten Sinterterrassen. Sinter sind mineralische Ausscheidungen an den Quellaustritten, die sich durch Entweichen von Kohlendioxid, also CO2, und durch Änderungen von Druck und Temperatur oder durch die Mitwirkung von Pflanzen bilden.
Fumarolen sind vulkanische Gas-Dampf-Gemische, häufig mit aggressiven Inhaltsstoffen, die die angrenzenden Gesteine zersetzen und in Gasen mitgeführte Inhaltsstoffe sublimieren können. Sublimieren bedeutet, dass die im Gas enthaltenen Inhaltsstoffe beim Abkühlen an der Erdoberfläche nicht verflüssigt werden sondern unmittelbar vom gasförmigen in den festen Aggregatzustand übergehen, wie man das aus dem Chemieunterricht vom Jod kennt. Solfatare sind Fumarolen, die Schwefelwasserstoff enthalten, der bei der Oxidation mit Luft an der Erdoberfläche zu elementarem Schwefel und schwefliger Säure umgewandelt wird.
Schlammvulkane haben mit einem echten Vulkan nichts gemein. Sie können an Austrittspunkten von Gasen entstehen, wenn nur geringe Mengen an Grundwasser mit hochgeschleudert werden und diese auf ein geeignetes Gesteinsumfeld treffen. Aus dem Zusammenspiel von Gas, Wasser und feinkörnigem Gestein entstehen dann die Schlammvulkane.
Von den vielen, durch hydrothermale Aktivität geschaffenen Kunstwerken beeindruckt mich persönlich der Grand Prismatic Spring im Midway
Geyser Basin am allermeisten.

Im Zentrum des etwa 90 m im Durchmesser messenden Pools karibisches Blau, das in grüngelbe Farben übergeht. An den Rändern ist bilderbuchartig die oben beschriebene, bunte Algenabfolge zu beobachten, die ein einzigartiges Farbenspiel erzeugen. Dabei werden zunächst leuchtend gelbe von leuchtend orangefarbenen und schließlich braunen Algenkolonien abgelöst. Wo die Wässer über den Poolrand flaserig und gelegentlich mäandrierend ablaufen, strecken die Algenteppiche ihre heißen braungelben und braunen Tentakel in die sie umgebende, scheinbar tote weißgraue bis dunkelbraune Landmasse aus und begrenzen den Pool in Form einer ausfransenden Corona. Für die Größe des Objekts sind die Laufstege eigentlich zu niedrig angebracht, von den Stegen aus lässt sich die wahre Pracht nicht vollständig erfassen. Hier wäre es tatsächlich einmal wünschenswert, man hätte eine Aussichtsplattform zur Verfügung. Ich verstehe aber, dass ein solch einschneidender Eingriff das Gesamtkunstwerk in seiner Wirkung erheblich beschädigen würde und man deshalb wohl darauf verzichtet hat. Begibt man sich aber auf die dem Geyser Basin gegenüberliegende Straßenseite, so befindet sich dort eine kleine Anhöhe von der aus man einen hervorragenden Ausblick auf den Grand Prismatic Spring hat.
Beeindruckend finde ich auch wie das aus dem Excelsior Geyser austretende Thermalwasser über eine Cascade in das Tälchen des Firehole River stürzt, um sich dort mit
dessen kalten Fluten zu mischen wobei sich auch hier wieder die leuchten gelben und orangefarbenen bis braunen Algenteppiche am Rande der Cascade ausgebildet haben. Beeindruckend finde ich auch,
dass es diesen Algen gelingt trotz der erheblichen, jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen ihren letzten Endes doch sehr begrenzten Lebensraum so erfolgreich zu verteidigen.
Weil das Midway Geyser Basin sehr nahe an der Straße liegt wurden wir im Vorbeifahren sehr früh auf dieses kleine aber ausgesprochen feine Geyser Basin aufmerksam. Als wir nun am folgenden Tag das Noris Geyser Basin besuchen sind wir fast schon ein wenig enttäuscht. Im Unterschied zu den übrigen Geyser Basins sind die Wässer hier sehr heiß und säurehaltig, so dass wir auf das Farbenspiel vom Vortag verzichten müssen. Trotz der weiten Wege, die wir gehen, treffen wir vielfach auf scheinbar immer gleich blass blaue oder fast farblose Geysire und Thermalquellen und mit dem Timing haben wir heute auch kein Glück. Die Zeitspannen, die wir wartend verbringen müssten, um den einen oder anderen Ausbruch zu sehen sind einfach zu lange oder liegen so ungünstig, dass wir uns entscheiden die Wege abzulaufen, hoffend die eine oder andere Überraschung zu erleben, die sich jedoch bis zum Ende unseres Weges nicht wirklich einstellt.
Als kleines Highlight streben wir am folgenden Morgen Old Faithful zu. Endlich ein Geyser, auf den man sich verlassen kann. Zwar versprüht auch er nicht, wie gelegentlich behauptet exakt alle 65 Minuten seinen heißen Inhalt in die Landschaft, aber mit der Deutschen Bahn kann er es an Pünktlichkeit locker aufnehmen. Da wir zeitig aufgebrochen sind, ist Publikum noch dünn gesät und so erleben wir nach nur zwanzig Minuten Wartezeit ein beeindruckendes Schauspiel, das uns nun besser verstehen lässt, warum Old Faithful allseits so hoch im Kurs steht.
Den Nachmittag verbringen wir im Upper Geyser Basin, das uns nun wieder durch deutlich variantenreichere hydrothermale Spielarten beeindruckt. Zwar finden wir kein so gewaltiges Pool wie den Grand Prismatic Spring, doch die hier zu besichtigenden Geysiere bestechen durch ihr Farbspiel und durch ihre teils beeindruckend ausgebildeten Sinterkrusten und –kegel. In diesem Teil des Yellowstone Parks beeindruckt mich insbesondere das Opalescent Pool in dem eine ganze Reihe abgestorbener Bäume in einem blaugrünen, manchmal auch rotbraunen Pool immer noch senkrecht stehend ihre Petrifizierung entgegengehen. Die graubraunen Stümpfe sind im unteren Teil von weißen Sinterablagerungen begrenzt und sehen aus als hätten sie Stiefel an.
Die Zeit, die wir für den Besuch des Yellowstone National Parks eingeplant hatten ist eigentlich schon verstrichen. Zudem haben wir von anderen Besuchern, die von Süden in den Park eingefahren waren, die Empfehlung erhalten einen Abstecher in den Grand Teton Nationalpark zu machen. Und so beschließen wir nach den vielen Geysieren ein Kontrastprogramm aufzulegen. Natürlich tauchen auch heute auf unserem Weg nach Süden immer wieder interessante Fotomotive auf und die Strecke ist wieder einmal länger als geplant und so wird es reichlich spät als wir das Zentrum des Nationalparks erreichen. Dem entsprechend sind alle Campingplätze belegt und wir müssen nach Jackson ausweichen, wo wir einen sehr einfachen aber kostenlosen Campingplatz finden, der zumindest unsere Spritkosten wieder hereinholt.

Also geht es am folgenden Morgen wieder gen Norden in den Park rein. Die Szenerie ist atemberaubend. Am Ende eines breiten Tales schraubt sich steil die zerklüftete Teton Range aus dem Tal fast 2.000 m gen Himmel empor wo die höchsten Gipfel immerhin mehr als 4.000 m erreichen.
Die steilen Flanken sind nur spärlich bewaldet. Am Fuße der Steilhänge nehmen stellenweise saftige Gebirgswiesen Platz, der größere Teil des Tals wird allerdings von
einer recht trockenen und kargen Buschlandschaft dominiert.
Entlang der Hauptstraßen ist reichlich Betrieb läuft man aber über die karge Ebene in westliche Richtung auf die Bergkette zu, so leert sich der Raum innerhalb kürzester Zeit, weil die allermeisten Touristen nicht bereit sind die Anstrengungen einer Wanderung auf sich zu nehmen. Es stimmt schon, dass das Netz an Wanderwegen nicht mit den alpinen Gegebenheiten mithalten kann. Das ist es aber genau, was das Reisen hier einfach anders macht als im alten Europa. Die Landschaften sind einfach wilder, sie sind entleert und sie haben immer einen gewissen Kick weil man nie so genau weiß, ob einem nicht doch einmal ein Rudel Wölfe, ein Bär, ein Elch oder ein Wapiti über den Weg läuft. Sicher ist es auch mühsamer durch das Gelände zu kommen, wenn man die eingetretenen Pfade verlässt, aber dann geht man halt etwas langsamer und benötigt etwas mehr Zeit wird dafür aber immer wieder mit Entdeckungen belohnt, die einem entlang der ausgewiesenen Wanderwege verborgen bleiben. Nachdem der Aufenthalt im Yellowstone eher den Charakter eines Bildungsurlaubs hatte, lassen wir vor diesem Alpenpanorama einfach Mal die Seele baumeln und schalten einmal richtig ab, um für neue Abenteuer gerüstet zu sein.


Unser Fernziel ist nun der Bundesstaat Washington. Um uns diesem zu nähern, folgen wir vom Grand Teton National Park aus der 26 bis Jackson. Von hier aus gäbe es eine etwas kürzere Route über den Teton Pass Highway in den kleinen Ort Victor und von dort aus dann weiter in westliche Richtung. Doch wir haben Bedenken, denn die Straße führt auf etwa 2800 m Höhe hinauf und der Motor zeigt schon seit einigen Tagen bei jedem Stopp weniger Neigung erneut anzuspringen ohne dass wir uns das so richtig erklären können. Wir möchten ungern abseits der Hauptstraße mit Motorschaden liegen bleiben und dann aufwändig abgeschleppt werden müssen. Also schlagen wir den etwas längeren, dafür aber vermeintlich bequemeren Weg ein und erhoffen uns im Notfall Unterstützung von den stets hilfsbereiten Einheimischen. Also geht es entlang der Straße 26 weiter in südliche, später in westliche Richtung bis Alpine wo der Snake River sein enges Tälchen verlässt und in das Palisades Reservoir mündet. Die 26 biegt nun im rechten Winkel wieder nach Nordwesten ab und verläuft parallel zum nordöstlichen Ufer des Reservoirs auf Idaho Falls im gleichnamigen Bundesstaat zu.
Vermuteten wir anfangs noch, unsere Startprobleme seien wieder einmal den kühlen Nächten geschuldet, so wird nun bei merklich ansteigenden Temperaturen immer deutlicher, dass es wohl der Anlasser ist, der demnächst die Grätsche machen könnte. Immerhin sind wir jetzt in der Lage uns hiergegen zu wappnen, in dem wir unsere Pausen immer auf Plätze oder Straßenabschnitte mit etwas Gefälle verlegen, so dass wir im Fall des Falles den Wagen durch Anschieben und Rollen lassen wieder starten können und nicht von vornherein auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Natürlich hat uns die Schleife nach Süden auch ordentlich Zeit gekostet und so ist es schon später Nachmittag als wir Idaho Falls endlich erreichen. Es ist ganz schön Verkehr, ständig werden wir an irgendeiner Ampel gestoppt, finden keine Werkstatt auch keinen Hinweis auf einen größeren Supermarkt und bekommen langsam Fracksausen, dass uns irgendwo im dichten Verkehr die Kiste ausgeht und wir dann einigen Stress haben unser Vehikel vernünftig geparkt zu bekommen. Also reißt mir schon bald der Geduldsfaden und ich überzeuge Angelika auf unserem geplanten Weg fortzufahren bis in das kleine Städtchen Arco, dessen überschaubare Größe eine weniger stressige Suche verspricht. Bei den letzten beiden Stopps hatten wir schon derart Mühe unser Vehikel wieder ins Laufen zu bringen, dass wir nun trotz hungriger Mägen bis ARCO durchfahren, wo wir uns einen geeigneten Schlafplatz in der Nähe der Hauptstraße suchen, um am nächsten Morgen die Reparatur unseres Fahrzeugs in Angriff zu nehmen.
So richtig gut haben wir unweit der Straße nicht geschlafen und so wachen wir etwas verkatert auf, frühstücken in einem Schnellrestaurant und finden zu unserem Erstaunen auch relativ schnell eine Werkstatt. Zum ersten Mal sind wir so richtig froh einen amerikanischen Wagen unser Eigen zu nennen, denn trotz dieser Einöde ist es nicht allzu schwierig Ersatzteile zu bekommen und nun bestätigt sich auch unsere Vermutung, dass der Anlasser der böse Bube war.
Während unser Gefährt in der Werkstatt auf Vordermann gebracht wird, ergänzen wir unsere Vorräte und finden auch einige Utensilien, die unseren Hausrat wieder etwas aufpeppen. Als wir gegen 14:00 Uhr zum zweiten Mal in der Werkstatt vorbeischauen, ist der ganze Spuk vorbei, unser Wägelchen zeigt volle Einsatzbereitschaft und ab geht es.
Das Yakima Valley
Wochenlang fahren wir nun schon unbekümmert Meile um Meile, ohne uns groß Gedanken um den Wagen zu machen. Einen ersten Dämpfer erhielten wir in den Black Hills, weil so mancher Geländeanstieg den Spritverbrauch bis auf 20 Liter hochschraubte. An den hohen Benzinverbrauch mussten wir uns seither leider gewöhnen, das ist der Preis, den die „Rockies“ fordern.
Jetzt aber stellen sich auch die ersten echten „Wehwehchen“ ein. Nach 4.450 Meilen ist der Anlasser hinüber, für 30 $ baut man uns einen Ersatz ein. Nach weiteren 300 Meilen bemerkt Angelika, dass der rechte Vorderreifen einseitig stark abgefahren ist und unverzüglich ausgewechselt werden muss. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, vermutlich ist die Spur des Wagens falsch eingestellt, das könnte uns noch mehr Reifen kosten. Außerdem steht ein Ölwechsel an und Wasser und die Bremsflüssigkeit müssten kontrolliert werden. Da auch unsere Küchenvorräte zur Neige gehen kommt uns Boise, die Hauptstadt Idahos, gerade recht. Nachdem wir mit etwas Mühe eine geeignete Werkstatt ausfindig machen konnten, geben wir den Wagen ab und gehen in einem nahegelegen Supermarkt einkaufen.
So konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und als alle Besorgungen erledigt sind geht es weiter auf der Interstate 80. Die nimmt zunächst direkten Kurs nach Westen, biegt aber noch vor der Staatsgrenze nach Nordwesten um, überquert bei Ontario den Snake River, erreicht Oregon und strebt dann dem Columbia River entgegen. Wieder einmal überrascht uns das Land. Wir kennen den Westen Oregons. Ihn kennzeichnen saftige grüne Wiesen, ausgedehnte Wälder, Wasser in Hülle und Fülle, dort ist die Heimat des Biebers. Hier im Nordosten hingegen herrscht völlige Trockenheit, soweit das Auge reicht kaum Bäume oder Sträucher nur verdorrtes Gras. Hinter Pendelton endlich der Columbia River, ein wenig Blau begrenzt von grünem Ufersaum. Jenseits des Flusses beginnt der Staat Washington. Der Fluss beschreibt hier eine große Schleife, die ich uns ersparen will. Statt dieser zu folgen wähle ich den direkten Weg nach Norden.
Noch einmal streift dann unser Weg für einige Meilen den Columbia River, bei Richland schließen wir uns dem Yakima River an und sind damit dem nächsten Etappenziel schon sehr nahe.
Von Anfang an war dies keine Urlaubsreise im herkömmlichen Sinne. Wir wollten nicht streng Tage und Wochen zählen, die an einem bestimmten Ort zu verbringen wären, sondern uns treiben lassen wie ein Floß auf einem langsam dahinfließenden Strom. Treiben lassen nicht von der Zeit, sondern von Stimmungen, Landschaften, Menschen oder irgendwelchen besonderen Ereignissen. Und es sollte auch kein oberflächliches, distanziertes, gleichgültiges Dahingleiten sein. Wir wollten tief in alles uns umgebende eintauchen, und wir wollten Kontakt mit Einheimischen jedweder Art. Schon zuhause überlegte ich, wie man dieses am besten bewerkstelligen könnte.
Eine mögliche Antwort schien uns zu sein, nach Arbeit Ausschau zu halten. Der finanzielle Aspekt spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Vor Jahren las ich einmal im National Geographic Magazine, dass tausende von Mexikanern auf der Suche nach Arbeit ständig weiter in den Norden der USA wanderten und sich anschickten nun auch vom nördlichsten Staat, nämlich Washington, Besitz zu ergreifen. Im Yakima Valley läge eines der weltgrößten Obstanbaugebiete, dass zur Erntezeit händeringend Arbeitskräfte suche. Das habe dazu geführt, dass sich mehr und mehr Mexikaner, illegal zwar, aber immerhin geduldet, dort niederließen, um fern der Heimat ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn dem so ist, sagte ich mir, dann werden wir beide umso weniger auffallen. Solange wir den Mund halten, gehen wir doch glatt als Amerikaner durch. Dies alles im Hinterkopf gedachten wir nun die Probe aufs Exempel zu machen.
Die Straße weicht nun kaum noch vom Yakima River, das hilft ein wenig über die brütende Hitze hinweg, die sich inzwischen eingestellt hat. Das hatten wir auf diesem Breitengrad und zu dieser Jahreszeit so auch nicht erwartet. Abseits des Flusses auch jetzt noch Hügel mit verdorrtem Gras, die andeuten, dass die Hitze hier nicht erst seit wenigen Tagen gastiert. Wo bitteschön soll in dieser Einöde und unter den gegebenen klimatischen Bedingungen ein Obstanbaugebiet herkommen? Die Antwort auf diese Frage kommt überraschend schnell. Mit einem Male stellen sich auf beiden Seiten des Flusses Grünflächen ein. Aus der Nähe betrachtet erweisen sie sich tatsächlich als mit Obstbäumen besetzte Haine, künstlich am Leben erhalten durch ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem. Wir fahren einige Meilen in die grüne Oase des ansonsten semiariden Landstrichs hinein und verlassen bei einer kleinen Ortschaft Namens Zillah den Interstate. Der Ortskern besteht aus einigen Lagerhallen und einem Supermarkt. Um diese „architektonischen Perlen“ gruppieren sich 30, vielleicht vierzig Häuser. Es ist Mittagszeit, die Sonne brennt unerbittlich, der Ort wirkt wie ausgestorben. Oberhalb des Häuserkonglomerats verlieren sich an den sanft ansteigenden Hängen der Rattlesnake Hills einzelne Farmen. Zwischen diesen sind die Orchards, die Obstbaumhaine eingeschaltet, grüne Quadrate und Rechtecke in dem ansonsten längst wieder ausgetrockneten Landstrich. Etwas planlos rollt unser Gefährt am Fuß der Hügelkette entlang. Eher zufällig entdecken wir einen Pavillon in dem Obst verkauft wird. Die Stirnseite des Obstladens ist ein wenig der Staßenfront alter Wildweststädte nachempfunden. Unter einem weit nach vorn ausgezogenen Dach, das reichlich Schatten spendet, türmen sich vor allem die Früchte der Region. Im Mittelabschnitt fehlt der Eingang. Stattdessen hat man kurzerhand die gesamte Wand herausgetrennt, so dass der Kunde unversehens vom Vordach in die großzügig angelegte Verkaufshalle tritt. Große rote Lettern über dem Verkaufsraum weisen diesen Ort als „Big Cherry Fruit Stand“ aus. Mit einer leichten inneren Unruhe verlasse ich den Wagen. Weit hinten in der kühlen Halle stehen zwei Frauen, unter dem Vordach macht sich ein älterer Mann an Obstkörben zu schaffen.
Angelika und ich überfliegen das Angebot an Obst und Gemüse. Alles sieht sehr frisch und lecker aus. Da der Verkauf direkt beim Erzeuger erfolgt, sind die Früchte natürlich auch entsprechend preisgünstig. Wir kaufen vier Pfund Pfirsiche, dazu Äpfel, Zwiebeln und eine Honigmelone und füllen die Vorratskammern des Vans auf. Gleichzeitig führen wir so eine Art Gesinnungsprüfung durch und überlegen, ob es wohl günstig sei hier wegen eines Jobs zu fragen. Irgendwie kann ich mich noch nicht so richtig dazu durchringen. Was ist, wenn uns jemand beim Sheriff denunziert? Am Ende können wir die Heimreise antreten. Ich habe auch noch nicht einen einzigen Mexikaner gesehen, wo sind die eigentlich alle? Einige Minuten drücke ich mich nochmals unentschlossen zwischen den Auslagen herum und nun scheint mir mein Ansinnen plötzlich ziemlich abwegig. Am liebsten würde ich geradewegs zum Van laufen, einsteigen und fortfahren. Als die ältere der beiden Frauen fragt, ob wir sonst noch etwas wünschen, gibt mir Angelika einen Schubs und meint, es könne doch nichts schaden, unseren Wunsch zu äußern. Da wir freundlich begrüßt wurden und die Frau auch sonst einen sympathischen Eindruck macht, ringe ich mich schließlich zu einer Anfrage bezüglich des Jobs durch.
Unser Anliegen scheint weniger ungewöhnlich als ich glaubte. Sie berät sich kurz mit dem immer noch unter dem Vordach arbeitenden Menschen und meint abschließend: „Ihr könnt schon morgen anfangen, die Kirschen müssen runter von den Bäumen.“ „Stellt den Wagen nachher vor unser Haus, alles weitere erfahrt ihr morgen früh.“ Dann beschreibt sie uns den Weg zur Farm. Ich gebe ihr zu verstehen, dass wir den Nachmittag in Yakima verbringen wollen und deshalb erst gegen Abend eintreffen werden. „Das geht in Ordnung, wenn ihr nicht zu spät aus Yakima zurückkehrt, dürft ihr gerne noch mal reinschauen.“
Dann geht es nach Yakima, erst in das Zentrum des kleinen Städtchens, später in den nahegelegenen State Park. Es gibt reichlich zu tun. Unser Wäschekorb ist bis zum Bersten voll, der Abwasch steht an, der Innenraum muss wieder einmal gründlich gesäubert werden. Zu guter Letzt ist duschen angesagt, im Schatten von Bäumen und Büschen klingt der Tag ruhig aus. Am frühen Abend biegen wir in die Schotterpiste zur Farm ein. Lautes Hundegebell begleitet die Ankunft. Ein kleiner Junge springt, neugierig welcher Besuch sich da ankündigt aus dem Haus, ihm folgt mit großen Schritten die nette Verkäuferin vom Obststand. Sie stellt sich als Becky Macy, die Frau des Obstfarmers Michael Macy und Mutter zweier Kinder, nämlich Jesse und Jeremy vor.
Zur Begrüßung reicht sie ein großes Glas kalten Eistees, genau das richtige zu dieser Jahreszeit. Anschließend bittet sie ins Wohnzimmer. „Michael ist noch nicht zuhause, im Sommer nimmt seine Arbeit fast kein Ende.“ „Oft verbringt er 14 bis 16 Stunden in den Orchards, am Abend ist er todmüde, fällt manchmal nach dem Essen geradezu ins Bett, um am folgenden Morgen schon wieder vor fünf Uhr auf den Beinen zu sein“, resümiert Becky ein wenig traurig und fährt fort:
„Deshalb ist der Winter unsere liebste Jahreszeit, da ist die Ernte eingebracht, arbeiten nur bis 6 Uhr möglich, im Dunkeln kann man schließlich keine Bäume beschneiden, und danach hat Michael viel Zeit für die Familie“. „Ich treffe mich öfter mal mit meinen Freundinnen, Michael geht gelegentlich auf die Jagd und das ganze Leben läuft in geordneteren Bahnen.“
Becky ist erstaunt über die Sorglosigkeit mit der Angelika und ich die Jobs hingeschmissen haben und losgefahren sind. Aber es erinnert sie an ihre und Michaels Zeit auf dem College in Seattle. „Die Hippie-Bewegung war damals auf ihrem Höhepunkt angelangt, es waren wunderschöne wilde Jahre, frei von Sorgen und Verantwortung.“ „Uns drängte es nicht gerade, eine Farm zu übernehmen, irgendwie sind wir dann doch hier hängengeblieben und heute kann ich mir kaum noch vorstellen bei Flowerpower dabei gewesen zu sein.“ Die Zeit ist weit fortgeschritten, von Michael immer noch keine Spur, ein bisschen in Sorge wegen des frühen Aufstehens morgen danken wir Becky für den netten Empfang und verschwinden in Richtung Van.
Am folgenden Morgen trägt ein laues Lüftchen leises Gemurmel aus den Obsthainen zu uns herüber. Eine große Schar von Pflückern hat sich auf der Wiese niedergelassen, wartet bis Michael von der Genossenschaft zurückkehrt um sein endgültiges OK zu geben, ob heute gepflückt werden kann. Wann geerntet wird, entscheiden nämlich die einzelnen Farmer nicht alleine, die Betriebe, welche die Früchte weiterverarbeiten haben ein gewichtiges Wort mitzureden. Bei den Pflückern handelt es sich um einen bunt zusammen gewürfelten Haufen aus Männern, Frauen und Kindern. Zwei Drittel der Leute sind Mexikaner, der Rest US-Amerikaner, dazwischen wirken zwei Deutsche wie Exoten.
Besonders für die Mexikaner scheint die Ernte eine Familienangelegenheit zu sein, bei ihnen nämlich hilft jeder, der laufen kann mit, ein möglichst großes Stück aus dem Erntekuchen herauszuschneiden. Natürlich täuscht hier der erste Eindruck. Wenn sie auch mehr Familiensinn als die „Gringos“ oder unsereiner aufbringen, so sind auch die kargen Löhne ein nicht zu vernachlässigender Grund für das große Aufgebot. Als einige der Arbeiter Michaels Pickup sichten, kommt Bewegung in den friedlich im Gras liegenden Haufen. Der Vorarbeiter gibt Körbe und Leitern aus und verteilt die Pflücker auf die abzuerntenden Bäume.
Uns Neulinge hält der Vorarbeiter noch eine Weile zurück. Zum ersten Mal sehe ich Michael, der schmunzelnd „Guten Morgen“ wünscht und wissen will, ob wir ok sind. Als ich dies bejahe, gibt er mir noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg und überlässt uns dann dem Vorarbeiter. Anfangs macht die Sache großen Spaß. In dem Hain mit 300 Bäumen setzt ein wildes Gekröhle und Gejohle ein. Besonders die jungen Mexikaner bringen ein Ständchen nach dem anderen. Ob es Liebeslieder sind oder einfach nur der Ausdruck überschäumender Lebensfreude, vermag ich nicht zu sagen, jedenfalls bändigt sie die Arbeit in keinster Weise. Die Bäume sind prall gefüllt mit süßen saftigen Kirschen, klar, dass da auch viele in die Münder wandern. An den sonnigsten Stellen fallen die Früchte fast ohne unser Zutun von den Ästen, bleiben mitunter an den Kleidern hängen, werden zerquetscht und hinterlassen dicke rote Flecken.
Als der untere Teil des Baumes abgeerntet ist, geht es auf die Leitern, die Arme sind nun schon ein wenig träge, auch das ungewohnte jonglieren auf der Leiter reduziert merklich das Tempo. Die kontinuierlich höher steigende Sonne brennt heftig, das zwingt uns, auf die Schattenseite der Bäume auszuweichen. Nach 12 Uhr wird die Hitze unerträglich. Die Kleider sind von innen heraus völlig durchgeschwitzt, von außen getränkt mit Kirschsaft, die Haut ziert eine dünne Salzkruste. Der Versuch, diese mit den inzwischen völlig verdreckten Händen und Armen abzureiben, bringt neuen Verdruss.
Was den Ernteertrag angeht, so stehlen uns die Mexikaner eindeutig die Schau. Während einer von ihnen singend 10 Körbe füllt, schaffe ich mal gerade deren 6 oder 7 und schnaufe noch dabei. Ausgerechnet jetzt fällt mir auch noch die alte Schlagzeile einer großen deutschen Tageszeitung ein, die da lautete: „Deutsche Arbeiter, die besten der Welt!“ Nur gut, dass das hier keiner gelesen hat.
Gegen zwei Uhr erreicht ein erlösender Ruf des Vorarbeiters den Hain. „Arbeit einstellen, Leitern ins Gras legen, morgen früh um 6 Uhr geht es weiter. Unsere Tagesausbeute ist dürftig, doch ich registriere voller Genugtuung, dass die Pflückerei gegen Ende auch für den Rest der Truppe kein Honigschlecken mehr war.
Zurück am Wagen, fragt Becky, ob wir nicht duschen möchten. Dieses Angebot braucht sie nicht zu wiederholen, wir lechzen nach Wasser. Schon lange nicht mehr habe ich ein Bad als so wohltuend empfunden. Als nächstes überrascht Becky mit kühlem Eistee und schon sind Angelika und ich erneut eingeladen, den Rest des Tages mit der Familie zu verbringen. Die Kinder freuen sich, neue Spielkameraden gefunden zu haben, toben mit uns den ganzen Nachmittag mal im Haus und mal im Garten herum. Sie planschen in einem kleinen Schwimmbecken, necken Angelika und mich mit kühlen Spritzern oder spielen Verstecken unter einer Trauerweide. Einige Male hetzen sie die Hunde auf uns, schließlich möchten die ja bei so lustigen Spielen nicht ausgeschlossen werden. Hin und wieder geraten auch die Jungs aneinander, dann müssen wir schlichten, sie mit einem Trick ablenken.
Becky nutzt die Zeit, um den Haushalt in den Griff zu bekommen. Nachdem sie ihre Arbeit erledigt hat, setzen wir uns gemeinsam ins Wohnzimmer und plaudern. Das ist der Beginn einer ganzen Reihe unvergesslicher Tage, die immer nach dem gleichen Muster gestrickt sind: Morgens Erntemühsal, gegen 2 Uhr duschen, mit den Kindern spielen bis Becky fertig ist und anschließend zusammen mit ihr den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Aus Beckys Erzählungen lernen wir allmählich den halben Ort kennen, zunächst rein theoretisch, später auch ganz praktisch, weil häufig Nachbarn auf der Farm oder am Obststand erscheinen. Aufregend sind ihre gedanklichen Ausflüge in alte Collegezeiten. Es scheint, als durchlebe sie diese nun noch einmal. Dann wieder schwärmt sie von Europa, würde zu gerne mal nach Paris, Rom oder London fahren, hofft, dass es, wenn die Kinder erst groß sind, möglich sein wird. Bei irgendeiner Gelegenheit muss ich wohl die Kochkunst der amerikanischen Küche beanstandet haben, Becky nimmt dies zum Anlass, uns eines Mittags mit meat loaf zu überraschen. Lecker!
Dass es mit der Inneneinrichtung des Vans nicht zum Besten steht ist ihr ebenfalls nicht verborgen geblieben. Deshalb kramt sie in ihrem Stoffvorräten bis ein geeignetes Stück gefunden ist, legt Nähzeug dazu und meint, damit könne Angelika Vorhänge und Taschen nähen. Angelika gibt ihr zu verstehen, dass ich bei uns der Schneider bin, reicht mir das ganze herüber und spöttelt: „Hier nimm, damit es dir nicht zu langweilig wird.“ Am Sonntag hat auch Michael etwas mehr Zeit als sonst. Zwar haben wir an mehreren Abenden schon einige Sätze mit ihm wechseln können, doch zu einem längeren Gespräch reichte es nie.
Während Becky und Angelika mit den Kindern spielen, bitte ich ihn, ein bisschen über den Farmbetrieb, die Vermarktung, die Verarbeitung und all die kleinen und großen Problemchen Drumherum zu erzählen. Das kostet ihn keine Mühe, wenn jemand so viel Zeit in den Beruf investiert, dann geht er wohl zwangsläufig in ihm auf. Gerade jetzt in der Erntezeit scheint er ständig zu simulieren, ob ihm auch ja keine Fehler unterlaufen, kein Termin abhanden gekommen ist.
„Du glaubst gar nicht, wie viel Arbeit auf so einer Farm anfällt, besonders in den letzten Tagen vor der Ernte.“ „Ständig muss die Qualität der Früchte im Labor überprüft werden. Das Ganze ist ein Spiel auf Zeit. Die vom Lager unten im Dorf warten am liebsten bis zum letzten Augenblick, um ein Maximum an Süße zu erzielen. Ich bin natürlich auch an guter Qualität interessiert, muss aber auch sehen, wie ich am Tage X ausreichend schnell die Pflückkolonnen zusammenbekomme. Außerdem weißt du inzwischen selbst, dass so ein Obsthain nicht in eins, zwei Tagen abgeerntet ist, sondern manchmal mehr als eine Woche Zeit braucht. Vom Pflücken bis zur Lieferung ins Lager muss alles durchorganisiert sein, und dann sind da auch noch die übrigen Orchards. Die Bäume müssen täglich bewässert werden, das ist auch der Grund, weshalb es am Abend immer so spät wird, bis ich heimkomme. Dann ist da Beckys Obststand, sie kann unmöglich nur die von uns erzeugten Produkte anbieten, die Leute wünschen Auswahl wenn sie einkaufen. Also bemühe ich mich Waren hinzuzukaufen, um das Angebot attraktiver zu machen. Dabei geht manchmal auch noch der halbwegs freie Sonntag „flöten“. So kommt eines zum andern und eh man sich versieht, ist der Sommer vorbei.“
Dann erklärt er mir, worauf man beim Beschneiden der Bäume achten muss, welche besonderen Probleme spätwinterliche Kälteeinbrüche mit sich bringen, was ihn sonst noch so übers Jahr beschäftigt und was er für die nahe Zukunft plant. „Ich denke, nun ist es genug“, bricht Michael den theoretischen Exkurs in Höhen und Tiefen des Obstanbaus ab, „sonst verbringen wir auch diesen Sonntag wieder nur mit Arbeit.“
Am Nachmittag fährt die Familie nach Yakima, Angelika und ich ziehen es vor, die nähere Umgebung zu erkunden. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich das Reservat der Yakimaindianer. Der Stamm hat ein Museum eingerichtet, das Auskunft über die Geschichte der Ureinwohner dieses Raumes gibt. Später fahren wir die Flussaue entlang nach Norden. Nun wird der Grünstreifen breiter, die Farmen sind größer, wirtschaftlich wohl auch lohnender. Neben Obst baut man auch Hopfen an. Überall sieht man die meterhohen Drahtgeflechte, geschmückt mit dem frischen Grün der schnellwachsenden Pflanze. Sollten wir demnächst in Zillah arbeitslos werden, dann besteht sicher die Möglichkeit, auch hier einen Job zu bekommen.
Nach 6 Tagen emsigen Pflückens sind die Kirschbäume leergefegt, dafür annähernd 300$ in unsere Taschen gewandert. Kein erhebender Anblick mehr, dieser Orchard, er sieht aus wie ein gerupftes Huhn. Mit der Arbeit ist es erst mal vorbei, doch verspüre ich wenig Lust, jetzt durchs Tal zu fahren und welche zu suchen. Lieber will ich die kurze Verschnaufpause nutzen, das Innenleben des Vans gründlich umzukrempeln. Beckys Freundin Sencie und ihr Mann Pat haben uns eingeladen, auch mal auf deren Farm vorbeizuschauen, das wollen wir heute gerne tun.
Pat und Sencies Farm wird nicht bewirtschaftet. Die beiden leben auf dem relativ großen Flecken Land in einem hübsch eingerichteten Holzhaus, sehen aber nicht ein, weshalb sie den Buckel krumm machen sollen für das, was andere als Wohlstand bezeichnen. Pat fertigt Holzspielsachen, die er auf Flohmärkten und bei ähnlichen Anlässen vertreibt. Sencie arbeitet als Krankenschwester. Während sie für den Lebensunterhalt sorgt, hält Pat das Haus in Ordnung.
Es ist in dieser Gegend nicht gerade üblich, Hausmann zu spielen, deshalb frage ich mich, was Pat dazu getrieben haben könnte. Becky erwähnte mal, dass er in Korea gekämpft habe, möglicherweise hat er dort so schreckliche Dinge erlebt, dass er sich, zurückgekehrt in die Arbeitswelt, einfach nicht mehr zurechtfand. Vielleicht hat er es aber auch satt, sich ständig von anderen Leuten herumkommandieren zu lassen. Wie dem auch sei, wir werden gewohnt herzlich aufgenommen. Zum wiederholten Male gilt es, von unserer Tour zu berichten, von Orten und Landschaften die hinter uns liegen und solchen, die hoffentlich bald auf uns zukommen mögen.
Dass es irgendwann auch nach Mexiko gehen soll nehmen die beiden mit Freude zu Kenntnis. Sie lieben dieses Land, waren viele Male dort und raten uns, es keinesfalls zu versäumen. Pat möchte mir auch beim Bau eines Bettes behilflich sein. Als es Zeit wird zu gehen sagt er, wir sollen morgen früh in einen Baumarkt fahren und „plywood“ besorgen, die nötigen Maschinen zur Verarbeitung habe er im Haus. Die Gelegenheit, endlich zu einem vernünftigen Bett zu kommen, stimmt uns euphorisch.
Gegen 10 Uhr treffen wir mit dem gewünschten Material bei den Patchinos ein. Nach dem Frühstück geht es gleich an die Arbeit. Pat misst den Innenraum aus, überlegt sich eine ihm geeignet erscheinende Konstruktion und bespricht deren Vor- und Nachteile mit uns. Sein Plan überzeugt, also willigen wir ein und schon markiert er auf den beiden überdimensionierten Holzplatten die auszusägenden Teile. Geduldig schneidet er ein Brett nach dem anderen aus der Platte, stutzt zuletzt auch die hölzerne Bodenplatte auf das notwendige Maß und bestreicht die ersten Teile mit Holzleim.

Dann bittet er mich beim Zusammenfügen der mit Leim bestrichenen Teile zu helfen. Unser Bett nimmt Gestalt an! Zuletzt vernagelt er die fertig gestellten Teile und prüft, ob alles so zusammenpasst wie es der Plan vorsieht. Inzwischen hat Sencie, wohl um uns ein wenig auf Mexico einzustimmen, Tacos zubereitet. Das sind Tortillas in die scharf gewürztes Hackfleisch eingerollt ist. Dem entsprechend treibt es uns allen den Schweiß in die Stirn. Um das Mahl etwas zu entschärfen, essen wir Unmengen von Salat.

Nach der Mittagspause bauen wir unser neues Schmuckstück in den Van ein. Pat hat die Bodenplatte so zugeschnitten, dass die ganze Konstruktion zwischen den Vordersitzen und hinteren Kotflügeln festsitzt. Kopf- und Fußteil des Bettes bestehen aus quaderförmigen Kisten, die reichlich Stauraum bieten. Die beiden Quader verbindet ein hölzernes Quadrat, das durch einen leichten Schlag gelöst und in einen Tisch umgewandelt werden kann. Am liebsten würde ich das Bett sofort ausprobieren, doch es ist Mittag und so muss ich mich schon noch eine Weile gedulden.
Für den Abend haben die Patchinos eine Diashow vorbereitet, die uns einen ersten Eindruck vom südlichen Nachbarn der USA vermittelt. Pat drückt mir auch einen Reiseführer in die Hand, den ich studieren und gegebenenfalls kaufen soll. Schließlich neigt sich auch dieser ereignisreiche Tag seinem Ende entgegen. Wir danken Pat und Sencie ganz herzlich für die geleistete Hilfe, versprechen, auch in den nächsten Tagen oder Wochen immer mal reinzuschauen und machen uns auf den Heimweg.
Von Michael erfahren wir am Abend, dass die Ernte für einige Tage unterbrochen werden muss. Da es im Staat Washington einiges zu sehen gibt, wollen wir unsere Zeit nutzen und dem nahegelegenen Mt. Rainier Nationalpark einen Besuch abstatten. Der Mount Rainier bildet mit dem Mt. Adams und dem Mt. St. Helens, um nur einige zu nennen, jene Küstenkordilliere, die dafür sorgt, dass die vom Pazifik herannahenden feuchtebeladenen Wolken hoch aufsteigen, dabei stark abkühlen und ihr kühles Nass noch vor dem Überschreiten der Wasserscheide an die steile Gebirgsflanke abgeben müssen. Für die dahinter liegenden Täler, wie zum Beispiel das Yakima Valley bleibt dann fast kein Niederschlag mehr übrig und die Sonne besorgt den Rest. Und so hat man an der Pazifikküste feuchtwarme Sommer, wie sie in Mittel- bis Nordeuropa üblich sind, wobei die Niederschlagsmengen allerdings die in Europa üblichen noch deutlich übersteigen. Sobald man sich aber zehn, zwanzig Meilen ostwärts der Wasserscheide im Tal befindet, glaubt man sich nach Nordafrika versetzt.
Als wir in den Nationalpark einfahren ist es feuchtnass. Nachdem wir nun seit fast zwei Wochen bei 36 bis 40 Grad Celsius gebruzzelt worden sind, genießen wir jedoch die gemäßigten Temperaturen und verschaffen uns im Visitor Center einen Überblick. Schautafeln, Publikationen und Diavorträgen entnehmen wir, was man sehen könnte, wenn es die Witterung zuließe. Sollte es in den nächsten Tagen nicht aufklaren, dann würden wir tatsächlich einiges verpassen.
Am folgenden Morgen haben sich die dicken Regenwolken vom Vortag verzogen, doch immer noch dampfen die Wälder und auch der Gipfel des mehr als 4.000 m hohen Mount Rainier mag sich nicht zeigen. Immerhin verheißt der Wetterbericht weitere Besserung und so beschließen wir unser Fahrzeug auf einem Parkplatz am Rande der Straße abzustellen und einen der backcountry-Campingplätze mitten im Wald aufzusuchen um dort eine Nacht zu verbringen. Unser vorbildlich angelegter Weg führt durch einen herrlichen Wald. Im Schatten der nur langsam abtrocknenden Bäume hält sich die Feuchtigkeit länger, so dass wir, endlich am Campingplatz angekommen doch etwas durchnässt sind und gleich ein Feuer anzünden, um uns ein wenig aufzuwärmen und die Oberbekleidung zu trocken. Zwar erfüllt das Feuer seinen Zweck, durch die Regenfälle der letzten Tage ist das Holz allerdings auch gut feucht, so dass das Feuer reichlich Rauch produziert, der bis zum Abend sowohl uns als auch unsere Kleidung und das gesamte Zelt in Räucherware verwandelt. Überall im Umfeld des Campingplatzes wird vor Bären gewarnt und darauf hingewiesen, dass man Lebensmittel keinesfalls im Zelt aufbewahren sollte. Vielmehr sollte alles Essbare an einem Seil so zwischen den Bäumen angebracht sein, dass auch der klügste Bär keine Chance sieht dort heranzukommen. Da sich bei dem etwas mühsamen Wetter nur wenige Wanderer in diese Einöde verirrt haben, ist uns schon etwas mulmig als wir die Warntafeln sehen. Aber wir halten uns strikt an die Anweisungen, sitzen bis spät am Abend am lodernden Feuer und hoffen schließlich die Nacht unbehelligt verbringen zu können.
Am folgenden Morgen werden wir von Vogelgezwischer geweckt. Unser Wecker zeigt erst sechs Uhr doch es ist schon taghell. Von Bären weit und breit keine Spur. Wir machen uns nur schnell einen Kaffee, um die nächtliche Kühle aus dem Körper zu bringen, packen zwischenzeitlich Zelt, Isomatten und Schlafsäcke und marschieren zurück zum Parkplatz. Ein Blick durch dass dichte Laubgeäst zeigt blauen Himmel und als wir mit unserem Gefährt am Fuße des Bergriesen angelangt sind, kann man schon erahnen was für eine tolle Aussicht der Tag heute für uns bereithält. Unser Blick geht hinauf zur majestätischen Bergspitze des Mount Rainier. Wir folgen einem Bergwanderpfad und steigen einige hundert Höhenmeter hinauf, um eine noch bessere Fernsicht zu haben. Aus dem dunkelgrünen Wäldermeer erheben sich majestätisch die Gipfel von Mount Adams, Mt. St. Hellens und einiger weiterer Berge, die uns aber namentlich nicht bekannt sind. Die Sonne zaubert angenehme Temperaturen. Wir lassen uns auf einer Bergwiese nieder und genießen den einmaligen Ausblick über große Teile des Staates Washington.
Am Nachmittag orientieren wir uns wieder in Richtung Zillah und verlassen den Park. Auf unserem „Heimweg“ finden wir einen vielversprechenden Campingplatz in einem National Forrest. Solche Campingplätze sind bei uns erste Wahl. Zum einen wird in aller Regel keine Gebühr erhoben. Trotzdem bieten sie den üblichen elementaren Standard mit großzügig bemessenen Stellplätzen und dem obligatorischen Grill. Darüber hinaus ist es, anders als in vielen Nationalparks meist erlaubt Feuerholz im Umfeld der Plätze zu sammeln und wenn man großes Glück hat ist sogar ein Holzplatz angelegt an dem ganze Berge von Holzscheiten lagern bei denen man sich dann frei bedienen darf. Eine häufig landschaftlich reizvolle Umgebung rundet dieses Konzept ab. Da macht ein Lagerfeuer dann so richtig Spaß. Wer jetzt also nicht unbedingt sein abendliches Fernsehprogramm benötigt und bereit ist bei den sanitären Anlagen einige Abstriche zu machen, der wird auf diesen Plätzen hervorragend bedient. Heute kommt zu alldem noch dazu, dass es sich um einen von Mitgliedern des Good Sam Club betreuten Platz handelt. Diese Leute, häufig rüstige Rentner mit Sinn fürs Gemeinwohl, achten darauf, dass kein Schindluder getrieben wird, dass der Müll dorthin kommt, wo er hingehört und dass die sanitären Anlagen eben nicht über die Maßen verdrecken sondern in einem ordentlichen Zustand verbleiben.
Der Platz ist heute nur spärlich belegt und so werden wir von den Betreuern des Good Sam Club direkt nach der Ankunft zum Kaffee eingeladen. Wie üblich verursacht unsere weite Anreise einiges Erstaunen. Wir bekommen den Trailer unserer Gastgeber gezeigt, werden dann weiter gereicht an die Nachbarn, sehen uns auch deren rollendes Heim an und bekommen wieder einmal allerlei nützliche Hinweise für die weitere Reise. Den Abend verbringen wir plaudernd mit unseren Gastgebern erhalten dann auch noch eine Einladung zum Frühstück und machen uns danach wohlgenährt auf den Rückweg nach Zillah.
Michael hat sich in unserer Abwesenheit auf den Nachbarfarmen nach Arbeit umgehört und ist fündig geworden. Bei einem Mann namens Judd beginnt die Pfirsichernte. Judd ist ein etwas merkwürdiger Typ, hat missionarische Ambitionen und versucht uns anfangs sporadisch später immer drängender zu Zeugen Jehovas zu „bekehren“. Immerhin hat er Arbeit für uns, tagsüber sehen wir ihn ohnehin kaum und so lassen wir uns auf das Abenteuer ein. Nach drei Tagen, die erste Lese neigt sich dem Ende zu, hat Judd plötzlich sehr viel Zeit. Ständig schleicht er im Orchard herum, nörgelt, meckert und versucht aus uns „gute Christen“ zu machen. Am folgenden Tag nervt er mich so sehr, dass ich es einfach nicht mehr aushalte. Wir bitten um den Lohn und gehen unseres Weges. Hätten wir jedem Mormonen, Baptisten, Zeugen Jehovas, den wir auf unserer Reise getroffen haben nachgegeben, wir hätten alle 4 Wochen unsere Konfession wechseln können!
Nachdem wir den Arbeitseinsatz bei Judd vorzeitig abgebrochen hatten, eröffnet sich nun noch einmal eine Gelegenheit die wunderschöne Landschaft des Staates Washington zu erkunden. Erneut geht es zum Mount Rainier National Park, in dem wir einen weiteren Sonnentag verbringen. Dann trübt sich das Wetter ein und wir setzen unsere Fahrt in Richtung Mount St. Hellens fort. Obwohl wir bis auf wenige Kilometer an den Vulkan bzw. das was von ihm noch übrig ist herankommen, sehen wir aufgrund des regnerischen Wetters so gut wie nichts von dem Berg. Da der Wetterbericht auch für die nächsten Tage keine Besserung erwarten lässt, ziehen wir etwas enttäuscht von dannen. Wir wollten nun eigentlich auf direktem Weg zum Olympic National Park aufbrechen, entscheiden uns dann aber nach Süden bis zum Columbia River zu fahren, um diesem dann bis an seine Mündung zu folgen. Wenige Meilen vor der Mündung in den Pazifischen Ozean, finden wir am Rande der Straße einen Parkplatz mit Grill auf dem wir die Nacht verbringen können. Eigentlich wollen wir am folgenden Morgen zeitig aufbrechen, doch dann begegnen wir einem freundlichen älteren Herrn, der uns auf einen Kaffee in seinen Trailer einlädt. Wenn das so weitergeht, dann können wir uns in der verbleibenden Reisezeit mit Einladungen durchschlagen und brauchen uns um alles weitere keine Gedanken mehr zu machen. Von den Cuttings, so heißen die Leute, die uns so mir nichts dir nichts vom Asphalt aufgelesen und in Ihre gute Stube eingeladen haben, erhalten wir die Adresse einer deutschen Auswanderin in einem nahegelegenen Küstenstädtchen. Die sollten wir unbedingt einmal besuchen, sie würde sich unheimlich freuen wieder einmal auf Landsleute zu treffen.
Wenn ich mir überlege, Bekannte von uns führen durch Norddeutschland träfen dort irgendwelche Leute von denen Sie annehmen, wir würden uns gut mit ihnen verstehen und lüden diese Leute dann zu uns ein, dann fände ich das schon ein wenig merkwürdig. Einladungen sind eine wunderbare Sache wenn die Chemie stimmt und die Einladungen auf direktem Wege ausgesprochen werden. Aber von Fremden bei Fremden eingeladen werden, das geht doch eigentlich überhaupt nicht, oder? Deshalb reagieren wir sehr zurückhaltend auf diesen Vorschlag, doch die Cuttings bestehen fast auf ein Versprechen ihrem Ansinnen Folge zu leisten. Wir bedanken uns für den Kaffee und machen uns auf die Reise. Der Ort, in dem die deutschen Auswanderer sich niedergelassen haben sollen heißt Ocean Park und liegt auf einer Halbinsel zwischen Pazifischem Ozean und einer landseitigen Bucht. Nach unserer Landkarte zu urteilen ist dies eine idyllische Gegend und so finden wir uns im Laufe des Tages tatsächlich in Ocean Park ein. Immer noch plagen uns Zweifel. Wir können uns doch nicht einfach bei wildfremden Leuten einladen, nur weil irgendein Bekannter meint, das sei eine gute Idee. Wir fahren einige Zeit unentschlossen kreuz und quer durch den weitläufigen Ort und entscheiden uns dann doch zumindest einmal Guten Tag zu sagen. Als wir bei Frieda Herdy, so heißt die uns wärmstens empfohlene Dame, vor der Tür stehen und diese uns öffnet, zeigt sie sich erwartungsgemäß überrascht und wir werden in unserem unguten Gefühl, die Leute einfach so zu überfallen bestätigt. Doch es dauert nicht lange und Frieda findet ihre Fassung wieder. Wir bekommen den nächsten Kaffee, plaudern 2 Stunden bis sie weg muss und erhalten dann den Ratschlag zwei junge deutsche Auswandererfamilien in unmittelbarer Nähe aufzusuchen, die sich garantiert riesig freuen würde uns zu sehen. Immerhin werden wir dieses Mal telefonisch angekündigt und so trauen wir uns auch nicht jetzt einfach davon zu fahren, wie wir es von Anfang an für richtig befunden hätten sondern machen uns auf den Weg zur angegebenen Adresse. Das Haus dieser Leute liegt versteckt im Wald. Den Briefkasten an der Stichstraße zum Haus übersehen wir mehrfach und so irren wir einige Male die Asphaltpiste hoch und runter bis wir dann endlich die Einfahrt erkennen.
Von völlig fremden Leuten werden wir freundlich willkommen geheißen und nachdem wir wieder einmal berichtet haben, was uns antrieb die weite Reise zu machen und wie es uns dabei ergangen ist, sind wir ganz neugierig zu erfahren, was unsere Gastgeber nach ihrer Zuwanderung alles so erlebt haben. Andrea und Wolfgang sowie Christel und Günther, so heißen unsere Gastgeber stammen aus Baden-Württemberg. Die Männer sind gelernte Schreiner und haben ihre Ausbildung noch in Deutschland absolviert. Ihr handwerkliches Können hat sich weithin herumgesprochen und so können sie über Aufträge für den Bau neuer Häuser nicht klagen. Mit den vieren samt deren noch kleinen Kinder verstehen wir uns vom ersten Moment an großartig und so werden wir eingeladen einige Tage mit ihnen zu verbringen. Das erste Highlight erleben wir noch am Mittag. Denn die beiden Schwäbinnen haben die einheimische Küche mit hier herüber retten können und so gibt es einen schwäbischen Zwiebelkuchen vom feinsten.
Da die Männer tagsüber auf der Arbeit sind, verbringen wir die Tage meist mit den Frauen und den Kindern und lernen dabei auch die Mutter von Wolfgang und Günter (Mimi) kennen, die mit ihrem Lebensgefährten (Ossi) im Nachbarhaus ebenfalls mitten im Wald wohnt. Dass unser Van durchaus noch die eine oder andere Aufwertung vertragen kann, ist den Frauen ebenfalls aufgefallen und so erhalten wir weiteren Stoff aus dem wir zusätzliche Stoffhängetaschen anfertigen, die wir später an den Wänden des Vans anbringen. So schaffen wir nicht nur immer mehr Stauraum sondern lassen auch die kahlen metallenen Wände des Fahrzeugs hinter bodenständiger Dekoration verschwinden.
Am Abend machen wir es uns dann in vollzähliger Runde gemütlich. Wie wir erfahren haben die beiden Familien das dicht mit Wald bewachsene Grundstück günstig erworben, haben die Bäume fällen, das Holz schneiden lassen, es abgelagert und dann aus dem Holz des eigenen Waldes ihr großzügig dimensioniertes Holzhaus gezimmert. Der Anfang war schwer, denn sie lebten zunächst beengt in zwei Trailern, die sie auf dem unerschlossenen Grundstück abgestellt hatten und so war jede Hausarbeit mühsam und langwierig. Irgendwann seien sie es Leid gewesen immer im Trailer leben zu müssen und so wären sie schließlich ans Werk gegangen, obwohl das Holz eigentlich noch etwas länger hätte abgelagert werden müssen. Das habe dazu geführt, dass das Haus gelegentlich etwas knarrt, aber man habe ich daran gewöhnt und es sei kein wirkliches Problem.
Am Wochenende gehen wir in der seichten Bucht baden und segeln ein wenig auf dem Gewässer umher. Für den Abend hat die Familie einen Film besorgt den wir uns bei Mimi und Ossi alle gemeinsam anschauen. Natürlich ist es auch schön wieder einmal muttersprachlich unterwegs zu sein und nicht ständig überlegen zu müssen wie der nächste Satz möglichst korrekt formuliert und ausgesprochen werden muss, damit unser Gegenüber auch wirklich alles versteht. Nach vier kurzweiligen Tagen erfahren wir aus Zillah, dass bald der nächste Arbeitseinsatz ansteht und so verabschieden wir uns und setzen unsere Reise fort.
Michaels Orchard ist inzwischen weitgehend abgeerntet und so behelfen wir uns mit Gelegenheitsjobs auf den umliegenden Farmen. Darüber hinaus haben wir uns in der Umgebung bei einigen Warehouses, in denen die Früchte sortiert und abgepackt werden nach Arbeit umgesehen, hatten dabei aber keinen Erfolg.
Nach wie vor verbringen wir unsere Freizeit gemeinsam mit Becky und den Kindern. An freien Tagen geht Angelika auch schon mal mit in den fruit stand, während ich mit Michael durchs Gelände fahre. Doch es braucht nie lange, bis Michael ein neues Betätigungsfeld für uns findet und so pendeln wir zwischen Arbeits- und Ruhetagen hin und her. Auf Judds Pfirsiche ernten wir Michaels, einige Tage darauf die Birnen von Michaels Vater. Letztere stellen uns, ihres Gewichtes wegen, noch einmal auf eine harte Probe. Als auch diese bestanden ist, folgen die Pflaumen, einige wenige Aprikosenbäume und die ersten Äpfel. Becky reicht uns in der ganzen Gegend herum, so werden wir von allen möglichen Leuten, darunter auch deutsche Einwanderer aus Ostpreußen, eingeladen und sind bald bekannt wie besagte bunte Hunde. Als kurz vor unserer Abreise ein Flohmarkt im Dorf abgehalten wird, nutzen wir die Chance, der Inneneinrichtung des Vans den letzten Schliff zu geben.
Ohne besonderen Grund wächst in uns der Wunsch, nun bald aufzubrechen. Bis zur letzten großen Ernte, der Apfelernte wird es nach Michaels Ansicht noch mindestens 2 Wochen dauern. Solange möchte ich auf keinen Fall warten. Außerdem sind wir auf das Geld ja nicht zwingend angewiesen und so reift in nur 2 Tagen der Entschluss, weiterzufahren. Natürlich gerät der Abschied zur Zeremonie. Es ist kaum möglich sich in so kurzer Zeit bei allen, die uns halfen, zu bedanken. Michael steckt uns am fruit stand noch eine Kiste Äpfel zu, zahlt den restlichen Lohn aus und sagt Lebe Wohl.
Zum letzten Mal biege ich in die Gravelroad zur Macyfarm ein, wo Becky mit den Kindern wartet. Dieser Abschied fällt besonders schwer, fast haben wir uns daran gewöhnt, die Mittage hier zu verbringen. Ich mache es kurz, um den Kummer nicht noch größer werden zu lassen. Jesse fragt seine Mutter, weshalb sie Tränen in den Augen habe. Sie antwortet: „Weil wir die beiden sehr sehr lange, vielleicht nie mehr wiedersehen werden.“
Aufbruch nach Kanada
Hätten wir geahnt, was uns in den nächsten Wochen erwartet, so wären wir nun nach Süden in den schönen Staat Oregon aufgebrochen, hätten uns die bezaubernde Oregonküste angesehen, sicherlich auch den Crater Lake und die riesigen Redwoodbäume in Nordkalifornien besucht und hätten uns danach vermutlich in San Francisco breit gemacht. So aber fahren wir nun, nach den sonnendurchfluteten Tagen im Yakima Valley braungebrannt gen Norden den Nationalparks Jasper und Banff entgegen, die wir bereits aus früheren Tagen kennen und lieben gelernt haben.
Von Yakima aus geht es über Ellensburg, Wenatchee und Cashmere bis zum Columbia River auf die 97, der wir nun nach Nordosten folgen. Bis zu dem kleinen Städtchen Brewster schmiegt sich die 97 mehr oder weniger eng an den Fluss an, dann lassen wir den Columbia hinter uns und erreichen kurz vor der kanadischen Grenze Oroville. Etwa 3 Meilen vor der Grenze übernachten wir auf dem Parkplatz eines Supermarktes zum vorerst letzten Mal in den Vereinigten Staaten.
Am Morgen des 3. September würden wir gerne die Grenze passieren, werden aber von den Grenzbeamten erst einmal ausgebremst, weil wir Obst und Gemüse an Bord haben, das nicht nach Kanada eingeführt werden darf. Die Äpfel der Macys schlagen wir uns größtenteils in die Bäuche, was uns später noch ein leichtes Magenkrummeln bereitet. Alle übrigen Obstvorräte und auch unser Sack Kartoffeln wandern schweren Herzens in die Mülltonne. Dann endlich dürfen wir passieren. Wir sind den Grenzern nicht wirklich böse, die tun auch nur ihre Pflicht und verglichen mit mittelamerikanischen Grenzübertritten ist das hier das reinste Kinderspiel. Was immer auch von einem verlangt wird, und wie unsinnig es einem auch manchmal vorkommen mag, man hat stets das Gefühl, dass das Prozedere nach demokratischen Spielregeln abläuft und wenn man einmal an einem Ort war, wo man dieses Gefühl nicht hatte, dann lernt man solche Momente trotz allem Verdruss richtig zu schätzen.
Als Tagesziel haben wir uns heute den Wells Gray Provincial Park ausgesucht, weil wir den noch nicht kennen und natürlich auch einige neue Eindrücke in Kanada sammeln möchten. Und so folgen wir weiter der 97 entlang des Okanagan Valleys und erreichen schließlich den Trans Canada Highway. Wir sind inzwischen deutlich mehr als 10.000 km gefahren und hatten, abgesehen von unserem nächtlichen Intermezzo in Maryland kein einziges Mal Trouble mit der Polizei. Das liegt aber auch daran, dass uns die tollsten Räuberpistolen über Radarkontrollen in entlegensten Gebieten erzählt wurden und wir deshalb stets bemüht sind das Tempolimit einzuhalten. Heute aber ist kein guter Tag, um diesem Vorsatz treu zu bleiben. Schon seit einiger Zeit bemerke ich, dass der Verkehr in Richtung „Trans Canada“ merklich zunimmt und wir immer mehr Fahrzeuge hinter uns ansammeln. Normalerweise ist das kein Problem, denn wir bevorzugen die ländlichen Räume mit wenig Verkehr und da bietet sich früher oder später immer eine Überholmöglichkeit. Heute kommt uns jedoch ein Auto nach dem anderen entgegen und so kann kaum überholt werden. Immer wieder fahren einige der hinter uns befindlichen PKW sehr nahe an unsere Stoßstange heran, um auch die kleinste Lücke für ein Überholmanöver nutzen zu können. Das macht mich nervös und so lege ich etwa 10 Meilen zu, hoffend dass die Strafe im Falle einer Verkehrskontrolle nicht zu hoch ausfallen möge. Doch den nachfolgenden Fahrzeugen ist auch das immer noch zu langsam, sie drängeln weiter und so entscheide ich mich die vorgeschriebene Geschwindigkeit wieder einzuhalten. Als wir den „Trans Kanada“ erreichen, wird der Verkehr noch dichter und wir sehnen die Abfahrt nach Norden herbei. Bei Salmon Arm überholt uns ein VW-Käfer, unterschätzt dabei jedoch die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Verkehrs und ist dann gezwungen unmittelbar vor uns einzuscheren. Als ich den Wagen bemerke ist es schon zu spät. Vermutlich hat er sich mit seiner nach vorn gebogenen rückseitigen Stoßstange an unserem Kotflügel verhakt und uns dabei regelrecht in den Graben geschubst. Wir rutschen eine etwa 0,50 m tiefe Böschung runter und rauschen dann in einen weiß gestrichenen Holzzaun einer angrenzenden Farm. Für einen Moment sind wir benommen, ich finde jedoch schnell wieder die Fassung und steige aus, um nach dem Unfallverursacher zu schauen. Der wird zwar langsamer hält aber nicht an und gibt dann plötzlich Gas um abzuhauen. Ich versuche einen der hinter uns stehen gebliebenen Fahrzeugführer zu animieren die Verfolgung aufzunehmen, doch die zeigen wenig Neigung meinem Ansinnen nachzugeben. Angelika ringt noch um Fassung als auch schon der Farmer aus dem Haus kommt, um sich den Schaden anzusehen. Noch leicht geschockt von dem Einschlag in den Zaun bringe ich nur mühsam einige Brocken Englisch heraus. Als ich jedoch kurz mit Angelika Deutsch rede bekommt der Farmer dies mit, gibt uns zu verstehen, dass auch er des Deutschen mächtig ist und spricht uns mit einem stark norddeutsch eingefärbten Akzent an.
Trotz des Schadens an seinem Eigentum ist der Farmer zunächst einmal um unser Wohlergehen bemüht, bittet uns ins Haus und verständigt die Polizei. Als wir uns etwas beruhigt haben, schlägt er vor unseren Van mit seinem Trecker von der Unfallstelle auf seinen Hof zu ziehen, damit wir nachschauen können, was eigentlich genau kaputt gegangen ist. Das nehme ich gerne an und so steht unser Van bald auf sicherem Terrain. Der Schaden am Zaun, einige kleine Beulen und Kratzer an der Karosserie und leichte Beschädigungen an einem der Vorderreifen fallen sofort ins Auge, insgesamt aber scheint der Einschlag in den Zaun weniger heftig gewesen zu sein, als uns der dabei entstandene Lärm glauben machen wollte. Den Abend verbringen wir gemeinsam mit der Familie. Während wir bisher stets gute bis sehr gut Erfahrungen mit deutschen Auswanderern gemacht haben, entwickeln wir im Laufe des Abends gemischte Gefühle. Das hat zunächst einmal wenig mit unserem Unfall zu tun, denn der zerstörte Zaun ist heute kein Thema mehr. Was uns unangenehm aufstößt ist der Umgang des Hausherrn mit seiner Familie. Er herrscht hier offensichtlich unangefochten und auch das kleinste Fehlverhalten, so es denn überhaupt eines ist wird barsch kommentiert. Die Töchter müssen tüchtig nach der Pfeife des Vaters tanzen. Mit einem weltoffenen, der Demokratie zugewandten Kanada kann ich die demütige Haltung, welche seine Töchter an den Tag legen nicht so recht in Einklang bringen. Vielleicht haben wir einfach nur den falschen Tag erwischt, denke ich mir. Ihm ist schließlich auch der Schrecken in die Glieder gefahren und so beschließen wir den Abend relativ früh und sind nicht wirklich unglücklich darüber, die Nacht in unserem Van verbringen zu dürfen.
Am folgenden Morgen werden wir zum Frühstück ins Haus gebeten. Das ist doch nett, denken wir uns, doch die Stimmung ist auch heute nicht wirklich gut. Schüchtern stellen die Mädchen uns einige Fragen zu Herkunft und Reise, der Patron hört sich das eine Weile schweigend an und fängt dann wieder an die Mädchen mit hollsteinschem Brummeln zurechtzuweisen. Wir erfahren, dass die Royal Canadian Mounted Police den Unfallverursacher wohl ermitteln konnte und wollen nach dem Frühstück gleich zur Polizei, um uns die Adresse des Unfallverursachers zu besorgen. Möglicherweise können wir im direkten Gespräch die Abläufe dann etwas beschleunigen, und die Versicherung dazu bewegen, den entstandenen Schaden zügig zu regulieren. Das gefällt dem Landwirt jedoch überhaupt nicht. Er möchte dass unser Fahrzeug als Pfand auf seinem Hof verbleibt, bis sein Schaden bezahlt ist. Ich versichere ihm, dass wenn unser Schaden bezahlt wird, er automatisch auch sein Geld erhält und das dies umso schneller der Fall sein wird, je mehr wir uns bemühen die Dinge voranzutreiben. Das scheint ihm zunächst einmal einzuleuchten und so dürfen wir mit unserem Gefährt den Hof verlassen. Die Polizei in Salmon Arm schickt uns weiter zur Polizeistation der RCMP in Chase. Dort eröffnet man uns, dass das flüchtige Fahrzeug tatsächlich gefunden worden sei, die Fahrerin jedoch bestreitet einen Unfall verursacht zu haben. Zumindest habe sie davon nichts bemerkt. Allerdings seien die Lackspuren am Fahrzeug eindeutig und insofern sei die Sache eigentlich klar. Allerdings dürfe man uns nach kanadischem Recht nicht die Anschrift der Unfallverursacherin geben.
Als ich bekunde, dass ich dies nicht verstehen könne, weil mir damit jede Möglichkeit genommen werde eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen wird der Beamte etwas unwirsch und weist daraufhin, dass man in Canada eine Demokratie habe. Das ärgert mich nun wieder und ich weise etwas spöttisch darauf hin, dass das seit einigen Tagen auch in Deutschland der Fall sei. Den Fall weiter eskalieren zu lassen bringt uns jedoch am allerwenigsten und so lasse ich mich von den Beamten damit trösten, dass die Versicherung den Fall bereits prüfe und am kommenden Dienstag weitere Informationen zu erwarten seien. Wieso am Dienstag, frage ich? Nun ja, Montag ist Feiertag. Wieder mal haben wir kein Glück und jetzt kommt auch noch Pech dazu. Na toll.
Wir fahren mit dieser frohen Botschaft zu unserem holsteinschen Farmer zurück, der natürlich noch weniger begeistert ist, weil er den Zaun eigentlich schon vor Schadeneintritt repariert haben wollte und so geht nun schon wieder das Theater mit der in Aussicht gestellten Beschlagnahmung unseres Fahrzeugs los, wobei ohnehin fraglich ist, ob er dazu überhaupt berechtigt wäre. Im Übrigen hat sich auch das familiäre Klima in keiner Weise gebessert und so halte ich es für das beste etwas Abstand zu gewinnen. Dem Patron erkläre ich, dass die Polizei darauf besteht, dass unser Fahrzeug schnellstmöglich wieder in einen absolut verkehrstüchtigen Zustand versetzt wird. Und siehe da, so etwas leuchtet einem Deutschen natürlich sofort ein.
Also machen wir uns vom Acker, schauen uns nach Werkstätten in der näheren Umgebung um und erfragen mögliche Reparaturkosten. Die Tage und Nächte bis zum Dienstag erscheinen uns endlos lange. Trotz Trans Canada Highway hängen wir in einem Nest ab in dem der Hund begraben zu sein scheint. Tagsüber treiben wir uns in Schnellrestaurants und am nahegelegenen See rum, die Nächte verbringen wir auf öden Parkplätzen. Stromversorgung haben wir keine, Ablenkung durch Fernsehempfang ebenfalls Fehlanzeige und touristische Attraktionen, die man eben mal schnell besuchen könnte liegen auch nicht in erreichbarer Nähe. Aber auch die schlimmste Zeit endet irgendwann einmal und so begeben wir uns am Dienstag hoffnungsvoll zu einem Prüfingenieur der Versicherung. Nun schlägt das Pendel wieder in unsere Richtung aus. Während der Mann der Unfallverursacherin von der Polizei gesagt bekam der Schaden an unserem Fahrzeug betrage lediglich 100 Dollar, ermittelt der Prüfingenieur nach gründlicher Durchsicht unseres Fahrzeugs nun einen Gesamtschaden von etwa 1.400 Dollar. Zu unserem Glück handelt es sich bei diesem Mann um einen Auswanderer aus Östereich, so dass wir sämtliche offene Fragen in Deutsch klären können und so ist auch eine weitere vermeintliche Hürde rasch genommen. Da wir den Schaden nicht vollständig reparieren lassen wollen, erhalten wir lediglich einen Nettobetrag von etwa 1.000 Dollar ausgezahlt, fahren noch kurz zu unserem Farmer um ihm mitzuteilen er möge wegen seiner Schadenregulierung Kontakt mit der Versicherung aufnehmen, verabschieden uns dann und begeben uns anschließend in Richtung Werkstatt.
Da wir einen Vorabtermin vereinbart hatten, lassen wir nun neue Reifen aufziehen, die Spur neu einstellen und vor allem die Bremsen überprüfen, denen wegen der Berge immer unsere größte Aufmerksamkeit gilt. Das alles kostet uns nun noch einmal einen halben Tag, doch den können wir nutzen um unsere Vorratskammer aufzufüllen. Als wir die Werkstatt frohen Mutes verlassen ist es bereits halb fünf und bis Jasper sind es noch ca. 400 km, das wollen wir uns heute nicht mehr antun, denn nachts kann es schon Frost geben und das unsichere Herumgurken bei mittelmäßigen Sichtverhältnissen und reichlich Wild auf den Straßen ist auch nicht unser Ding. Da es spät dunkel wird, arbeiten wir uns immerhin noch bis auf 200 km an Jasper heran, finden dann in Ortsrandlage eine Wiesenfläche unweit der Straße und schlagen dort unser Nachtlager auf.
Seit wir Zillah verlassen haben ging das Quecksilber auf unserem Weg nach Norden beständig nach unten. Bis Salmon Arm konnten wir noch ganz gut mit den sinkenden Temperaturen und dem sich eintrübenden Himmel leben, heute Nacht aber war es zum ersten Mal wieder richtig kalt und so müssen wir einige Kilometer zurücklegen bis die Wagenheizung die nächtliche Kälte aus unseren Körpern vertrieben hat. Die ganzen 200 km bis Jasper bleibt der Himmel grau. Es nieselt ein wenig, von der schönen Bergwelt, die wir schon einmal erleben durften ist nicht viel zu sehen. Selbst einige höher gelegenen Teile des wunderschönen nordischen Nadelbaumwaldes hüllt dicker Dämmer ein. Ich liebe diese dicht gestaffelt stehenden, kleinwüchsigen Nadelbäume, die dank ihrer Größe und ihrer schlanken Wuchsform auch den schlimmsten Blizzards die Stirn bieten.
In Jasper angekommen nehmen wir auf dem Whistler Campingplatz Quartier und beratschlagen, wie wir die nächsten Tage verbringen wollen. Draußen fängt es unterdessen an richtig zu schütten. Von den Bergen ist nun überhaupt nichts mehr zu sehen. Nebelschwaden überziehen das ganze Tal und uns bleibt nichts übrig als fehlende Tagebucheinträge zu ergänzen, die Finanzen zu checken, einen Kaffee nach dem anderen zu schlürfen und zu hoffen, dass das Wetter bald umschlagen möge.
Noch immer steckt uns Salmon Arm in den Knochen. Was uns jetzt so richtig gut täte wäre ein blauer Himmel. Wir könnten unser rollendes Heim verlassen, am Rande der Berge wandern gehen, das Wild käme vermehrt aus dem Wald und wir würden sicher viele Tiere vor die Linse bekommen, vor allem aber wären wir nicht die ganze Zeit auf unserer Sardinenbüchse zurückgeworfen. Die uns umgebende Landschaft ist unser Wohnzimmer und wenn wir dieses nicht betreten dürfen oder können hängt der Haussegen schief. Es fällt uns nicht leicht der Wahrheit ins Auge zu blicken. Wir hatten uns so auf Jasper gefreut, wollten vielleicht noch weiter nach Norden wenn es das Wetter zugelassen hätte. Doch die graue, kalte, stimmungstötende Ödnis lässt uns wenig Spielraum. Und so beschließen wir schweren Herzens Jasper, ohne es überhaupt richtig gesehen zu haben, hinter uns zu lassen und in Richtung Banff aufzubrechen.
Tatsächlich erringen wir damit einen kleinen Erfolg. Zwar bleiben auch die folgenden Nächte kühl doch der Regen lässt nach, hört schließlich ganz auf und ermöglicht uns nun den einen oder anderen Ausflug in die Natur. In Banff decken wir uns nach den Erfahrungen der letzten Tage auch mit warmer Unterwäsche, mit Handschuhen und dicken Socken ein und so sind wir den Launen der Natur nicht mehr ganz so stark ausgeliefert wie bisher. Doch schon nach 2 nicht wirklich schönen aber immerhin erträglichen Tagen trübt es wieder ein. Kanada bringt uns dieses Jahr kein Glück und so steuern wir nach nur eineinhalb Wochen erneut der 49. Breitengrad, also die Grenze zu den USA an, hoffen in südlicheren Gefilden endlich auf erträglichere Temperaturen und weniger Nässe zu treffen.
Bei Eureka geht es über die Grenze nach Montana. Nachdem wir dem Grenzer bereitwillig über unsere weiteren Reiseziele Auskunft gegeben haben, dürfen wir schon nach 10 Minuten unsere Fahrt fortsetzen. Was haben die nur davon uns derart auszuquetschen? Wir können doch erzählen was wir wollen, überprüfen kann das Männeken an so einem kleinen Zollaußenposten doch sowieso nicht, ob das wirklich stimmt.
Es widerstrebt uns permanent Spielball der Kältefluten zu sein, die über die Nordwest-Südost verlaufenden Täler beständig ihrer eisigen Zungen nach uns ausstrecken. Verliefe hier ein Gebirge ähnlich den Alpen von Ost nach West, so umgäbe uns nun womöglich ein mediteranes Klima, zumindest könnten wir uns in gemäßigten Breiten bei erträglichen Temperaturen bewegen und wären die Nachtfröste los. Die Aufstockung unserer Winterbekleidung hat immerhin bewirkt, dass wir uns nun während des Tages unbeschwert bewegen können, doch die Nächte bereiten uns weiterhin wenig Freude.
Wir gewinnen weitere 70 bis 80 Meilen in Richtung Süden. Die Straße ist kaum befahren, wir sind niemandem im Wege und so rollt unser Gefährt mit gemütlichen 40 Meilen gen Süden bis die Straße schließlich nach Westen zum Glacier Nationalpark abbiegt. Bei West Glacier fahren wir in den Park ein. Die Straße schmiegt sich zunächst an den McDonald Lake, beginnt an dessen Ende langsam anzusteigen und bewegt sich schließlich in gewagten Serpentinen hinauf zum Logan Pass. Auf halber Höhe setzt Schneetreiben ein, so dass wir wegen der Sommerbereifung schon überlegen den Rückweg anzutreten. Die Straße bleibt jedoch schnee- und eisfrei, so dass wir unseren Weg fortsetzen. Ohne Vorwarnung springt uns aus dichtem Unterholz ein Bär direkt vor den Wagen. Da wir wegen des Wetters jedoch langsam fahren und bergauf auch schnell zum Stehen kommen, bleibt es bei einer kurzen Schrecksekunde und schon ist Meister Petz aus unserem Blickfeld verschwunden. Am Pass angelangt umgibt uns ein eiskalter stürmischer Wind mit Schnee und Graupelschauern. Von der langen Fahrt bestens aufgewärmt steigen wir trotz des schlechten Wetters aus, um etwas Frischluft zu schnappen. Warm angezogen übt auch das wilde, stürmische Treiben auf dem Pass eine gewisse Faszination aus. Zwischen einzelnen Windboen reißt die Wolkendecke auf und gibt für einige kurze Momente den Blick in die umliegenden Täler frei. Nach einer Viertelstunde begeben wir uns gerne wieder in unser Gefährt und bewegen uns vorsichtig gen Osten ins Tal hinunter. Dort finden wir einen wunderschönen Campingplatz mit reichlich Holzvorräten aus denen sich vortrefflich Feuer machen ließe, wenn es denn trocken wäre. Ist es aber nicht! Und so habe ich meine liebe Mühe und Not ein Feuer zu entfachen. Unter etwas abenteuerlichen Bedingungen bereiten wir das Nachtmahl und packen uns anschließend dick ein, um einer weiteren kalten Nacht zu trotzen.
Früh am Morgen wachen wir auf. Gut verpackt ließ es sich aushalten, aber der Atem scheint im Van zu gefrieren und die Fenster sind teilweise mit Eisblumen geschmückt. Bis wir endlich unsere nächtliche Kleidung abgelegt und Jeans und Oberbekleidung angezogen haben sind wir so am Schlottern, dass ich den Fuß beim Starten des Wagens nicht ruhig halten kann, so dass die Maschine absäuft. Nicht nur wir, auch das Kraftwerk unseres rollenden Heims hat so langsam die Faxen dicke und beginnt zu streiken als wir versuchen die abgesoffene Kiste durch wiederholtes Starten wieder flott zu bekommen. Nach 15 Minuten vergeblichen Bemühens wird ein Ranger auf uns aufmerksam, der uns mit einem Starterkabel die Weiterfahrt ermöglicht. Wir umrunden den südlichen teil des Glacier National Parks, erreichen so erneut West Glacier und bewegen uns dann in Richtung Kalispell. Von Kalispell aus geht es zum Flathead Lake, an dessen Uferlinie entlang ins gleichnamige Indianerreservat und kurz vor Missoula auf den Highway 90. Wieder einmal haben wir zu wenig Fahrtzeit kalkuliert, als wir den Highway erreichen ist es längst dunkel. Der Himmel, schon den ganzen Tag wolkenverhangen, öffnet seine Schleußen und läßt es prasseln. Schließlich geht der Regen erneut in Schnee über, die Straße wird rutschig. Mit Sommerbereifung will ich mich auf nichts einlassen, also wird die nächste Rest Area unser Nachtlager. Erschöpft von der anstrengenden Fahrerei, fallen uns bald die Augen zu.
Herbst im Yellowstone National Park
Ein neuer Kälterekord weckt mich in den frühen Morgenstunden. Gerade noch schien ich auf ein mollig warmes Nachtlager gebettet zu sein und nun klirrende Kälte. In Yakima schliefen wir, der großen Hitze wegen, oft nur mit Mühe ein, heute, nur drei Wochen später, dürfen wir Eis kratzen.
Wir versuchen uns gegenseitig aufzuwärmen, das hilft auch ein wenig, doch die Füße werden kalt und kälter. Gegen 5 Uhr ist es nicht mehr auszuhalten. Ich versuche den Van zu starten, lasse ihn aber vor lauter Zähneklappern wieder einmal absaufen. Angelika ist in dieser Sache geschickter, sie hat mehr Geduld, versucht nach zehn Minuten Pause noch einmal zu starten und packt es auch zu unserem Glück. Nach weiteren zehn Minuten schafft das Gebläse endlich freie Sicht, langsam tauen die starren Glieder auf und es kehrt neues Leben in unsere Körper zurück. Auf der Straße hat sich eine geschlossene Schneedecke gebildet. Der Wagen schlingert über die Piste, mehr als 30 Meilen sind nicht drin. Bei Garrison verlassen wir den Highway, streben auf der Staatsstraße 287 Helena, der Hauptstadt des Bundesstaates Montana zu. Am MacDonald Pass wird es kritisch. Die Straße steigt auf einer langen Geraden bis auf 1900 Meter hinauf. Immer dichteres Schneetreiben nimmt die Sicht nach vorn, zwingt zu verhaltener Fahrweise. Am Straßenrand, vier oder fünf liegen gebliebene LKW, vor uns quälen sich zweie im Schritttempo zum Pass hoch. Wenn ich jetzt anhalten muss, schaffen wir es nicht mehr über den Berg zu kommen. Also schlage ich das Steuer vorsichtig ein, ziehe den Van nach links auf die völlig zugeschneite Überholspur und schleiche an den Brummis vorbei.
Immer noch kein Scheitelpunkt in Sicht, es ist zum Verzweifeln. Unser rollendes Heim wird Meter für Meter langsamer, droht jeden Augenblick stecken zu bleiben. Mit letztem Ruckeln kommen wir oben an - uff, das wäre geschafft. In Helena dann der nächste Schreck. Während der Fahrt geht ohne Vorwarnung plötzlich der Motor aus, lässt sich auch nicht mehr anwerfen. Wie sich später herausstellte hatte sich die Halterung der Batterie gelockert, die Kabel bekamen Kontakt zur Karosserie und entluden das altersschwache "Kraftwerk". Glück im Unglück, nach wenigen Minuten schon ist ein rettender Engel zur Stelle, hilft unserer Karre wieder auf die Sprünge. Dreißig Meilen südöstlich Helena, am Ortsausgang von Townsend, wirbt ein gutes Dutzend parkender LKW für eine Fernfahrerkneipe. Ein heißer Kaffee und eine schöne warme Mahlzeit, das wäre jetzt genau das richtige. Der Laden ist brechend voll, bei der Kälte kein Wunder. Die meisten scheinen sich zu kennen, erzählen aufgeregt und lautstark Geschichten, hadern mit dem Wetter, dabei essend und haufenweise Kaffee schlürfend.
In dem Gewimmel werden wir erst einmal überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Vermutlich sieht man uns irgendwie an, dass wir hier eigentlich überhaupt nicht hergehören. Vielleicht ist es hier aber auch Sitte lautstark Speisen und Getränke zu ordern, wie das gelegentlich geschieht und wir sind einfach zu zaghaft. Das Lokal ist auch völlig überhitzt und weil wir in unserem meist unterkühlten Gefährt im Zweifel frieren und deshalb gut eingemummelt eingetreten sind, fangen wir bald an zu schwitzen und legen ein Kleidungsstück nach dem anderen ab.
Irgendwann nimmt die Wirtin schließlich auch uns zur Kenntnis und kommt grantig brummelnd, mit mürrischem Gesicht und schiefsitzende Perücke auf uns zu. Sie ist ganz kurz angebunden, murmelt etwas, das ich nicht verstehe, doch ich habe inzwischen mitbekommen, dass man hier schnell reagieren muss, wenn man bedient werden möchte. Also schieb ich blitzschnell hinterher 2 Mal Eier mit Speck und Bratkartoffeln, was offensichtlich angekommen ist, denn das obligatorische Wasser und der Kaffee stehen unversehends auf dem Tresen und wir wärmen unsere Hände und Bäuche mit den Koffeincocktails.
Während wir auf das Essen warten schweift mein Blick durch den Raum, wandert zufällig auch an die Decke und bleibt dort ungläubig hängen. Da steht doch tatsächlich, dass jeder dem hier irgendetwas nicht passt sich zum Teufel scheren soll. Das erinnert an diese "love it or leave it - Mentalität", auf die man in den Staaten immer mal wieder trifft und die besagt, dass man Amerika lieben muss oder verschwinden soll.
So rauh die Schale, so spröde das Auftreten, so deftig unsere Eier mit Speck und Bratkartoffel. Zwei richtig schöne Portionen herrlich duftend, ein Gedicht. Unsere Gedanken lagen wohl auf einem Silbertablett vor ihr ausgebreitet als sie das Essen brachte, unerwartet kommt ihr ein Lächeln über die Lippen als sie die Teller über den Tresen schiebt. Na also, es geht doch. Uns guten Appetit zu wünschen ist dann allerdings des Guten zu viel, die Leute in Montana müssen offensichtlich mit ihren Kräften haushalten. Gerne lassen wir uns noch mehrfach Kaffee nachschütten, zahlen und verlassen die etwas gewöhnungsbedürftige Lokalität.
Draußen hat es aufgehört zu schneien, nur die Kälte der Nacht umklammert immer noch fest Mutter Erde. Innerlich aufgewärmt kommt sie jetzt aber kaum mehr an uns ran. Allerdings ist unsere Batterie noch nicht vollständig wieder aufgeladen und so stottert selbst der warme Motor beim Starten, erhört aber nach einigen Fehlversuchen mein Flehen und springt an. In einem Rutsch geht es nun auf die Interstate 90 der wir bis Livingston folgen. Dort heißt es vor dem herbstlichen Besuch des Yellowstone National Parks Lebensmittel bunkern und dann geht es auf die 89, die dem Yellowstone River nach Süden folgt.
Einige Meilen nördlich des Yellowstone Parks, führt eine Schotterpiste in Richtung Gallatin National Forrest. Am Ende der Straße befindet sich in wildromantischer Umgebung ein Campingplatz am Rande eines kleinen Bergsees. Man glaubt sich am Ende der Welt. Und doch zeugen frisch eingehängte Müllbeutel von ständiger Betreuung und Sorge um diese urwüchsige Landschaft.
Hochgewachsene Gräser, die bereits ihr herbstlich gelbbraunes Kleid angelegt haben, bedecken Seeufer und Hügel. In der Ferne ringsum verschneite Bergketten. Kalter Wind fegt über den See, kräuselt den Wasserspiegel. Wir sind ganz alleine. Längst sind Amerikas Touristenströme zurückgekehrt an die Arbeitsfront, im Yellowstone gibt es ausreichend Platz, wer sollte sich da noch für diese wenig luxeriöse Bleibe entscheiden. Dabei wäre uns Gesellschaft durchaus willkommen. Das Feuerholz ist nass, teilweise angefroren. So braucht selbst das Kaffeewasser 40 Minuten. Einen alten Pyromanen wie mich stört das wenig, zündeln macht Spaß, die Flammen wärmen angenehm. Die Kälte ist jetzt besser zu ertragen, weil sie inzwischen deutlich trockener daherkommt.
In Livingston habe ich mir aus Jux und Dollerei einen Drachen gekauft. Damit geht es auf einen der Hügel. Die frische Brise trägt ihn rasch hinauf ins sonnengetränkte Grau. Wie die Kinder tollen wir um den See, blödeln, lassen Steine übers Wasser tanzen, streichen mit den Fingern durchs eiskalte Nass. Am Nachmittag verirren sich dann doch noch zwei Wohnmobile in diese Einöde - das beruhigt uns. Zum einen waren wir nicht gerade begeistert die Nacht hier alleine zu verbringen, zum anderen macht mir die Batterie Sorgen, da ist es doppelt wichtig eine helfende Hand in der Nähe zu wissen.
Die Nacht war weniger kalt als befürchtet. Zwar heißt es wieder einmal schlottern bis die Kleidung gewechselt ist. Aber draußen ist es trocken und so haben wir bald
ein Feuer entfacht, um uns etwas aufzuwärmen und ein gemütliches Frühstück einzuläuten. Einen Vorteil hat das kalte und gelegentlich auch garstige Wetter aber doch. Beim Verlassen der
Campingplätze müssen wir wenig Mühe aufwenden um das Feuer zu löschen. Von Waldbrandgefahr derzeit keine Spur.
Schließlich brechen wir auf nach Gardiner und erreichen den wohl schönsten Zugang zum Yellowstone National Park, den steinernen Torbogen des Roosevelt Arch. Im Jahre 1903 legte Präsident Theodor Roosevelt höchstselbst den Grundstein und noch im selben Jahr wurde das Bauwerk fertiggestellt.

Der Roosevelt Arch am Nordeingang des Yellowstone National Park.
Historisch gesehen war der Nordeingang die Haupterschließungsroute in den Park und bildet auch bis zum heutigen Tage das Verwaltungszentrum. Dies dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, warum man sich hier bereits an der Parkgrenze besondere Mühe gab ein möglichst positives Bild abzugeben. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Eisenbahnverbindung bis an die Parkgrenze. Reisende, die den Yellowstone Park besuchen wollten, mussten in Cinnabar / Montana in Kutschen umsteigen und gelangten auf diese Weise nach Gardiner. Auch als die Bahn Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich Gardiner erreichte, war das Haupttransportmittel immer noch die Kutsche und selbst als nach dem zweiten Weltkrieg die Automobile überall Einzug gehalten hatten war der Besucherstrom noch so dünn, dass der Torbogen seinen Zweck als monumentale Grußadresse über viele Jahrzehnte erfüllte. Der Torbogen war jedoch nicht für den Massentourismus ausgelegt und so hat er sich in der Hauptreisezeit mittlerweile zu einem Nadelöhr für die nördliche Zufahrt zum Park entwickelt. Die Parkverwaltung hat sich deshalb entschlossen eine Umgehungsstraße zu bauen, die Straße durch den Torbogen jedoch weiter offen zu lassen, da diese Zufahrt vielen Touristen als willkommenes Fotomotiv dient.
Wir haben inzwischen das Besucherzentrum erreicht und arbeiten eine Route für die nächsten Tage aus. Entgegen unserer Erwartungshaltung könnte uns die Stellplatzsuche auch im Herbst beschäftigen, denn die Parkverwaltung hat mit Rücksicht auf den zurück gehenden Besucherandrang einige Campingplätze geschlossen. Also suchen wir nach bewährter Manier zunächst einen Stellplatz für die Nacht und brechen dann zu einer Exkursion in Richtung Mammoth Hot Springs auf.
Die terrassierten Thermalbecken von Mammoth Hot Springs wurden bzw. werden durch Thermalwasser erzeugt, das hier entlang der Norris-Mammoth Störung aufsteigt. Mammoth Hot Springs liegt deutlich abseits der übrigen Geyser Basins (vgl. Yellowstone-Kärtchen) und unterscheidet sich auch in der Zusammensetzung seiner mineralischen Fracht. Während die Mehrzahl der Thermalquellen im Yellowstone Park Geiserit, ein amorphes Silikat bzw. eine Opalvarietät (amorphen Stoffen fehlt das Kristallgitter) ausscheiden, bestehen die Sinterterrassen von Mammoth Hot Springs überwiegend aus Travertin (Calciumcarbonat, CaCO3). Der frisch abgelagerte Travertin ist ein poröser und deshalb meist leichter Kalkstein von weißer Farbe, der im Laufe der Zeit verwitterungsbedingt weißgraue oder graubraune Farbtöne annimmt. Tatsächlich gibt es innerhalb des riesigen Terrassenkomplexes einige Abschnitte in denen diese monotone und wenig eindrucksvolle Farbgebung ausgeprägt ist. Immer dann aber, wenn sich wärmeliebende Algen angesiedelt haben oder farbgebende Mineralien mit an die Oberfläche gespült werden, zeigt sich auch hier die farbenfrohe Ausgestaltung wie wir sie schon an vielen Orten im Park sehen durften.
Zu Beginn unserer Exkursion wählen wir den bequemen Weg und bewegen uns über die Laufstege am Fuß der Terrassen entlang. Hier wird vor allem die monumentale Größe dieser Sinterablagerungen erkennbar. Ihr volles Potential entwickeln die Terrassen jedoch erst, wenn man von einem höher gelegenen Aussichtspunkt auf die Becken schaut. Das durch die mineralischen Inhaltsstoffe des Wassers und die Algenmatten erzeugte Farbspektrum reicht von blauen und gelbgrünen bis zu braunorangefarbenen und tiefbraunen Farbtönen. Durch die Ausbildung der vielen kleinen Einzelterrassen wird dieses Farbenspiel noch unterstützt.
Schon aufgrund der schieren Größe ist es bei Mammoth Hot Springs nicht immer möglich nahe an die Travertinbecken heranzukommen. Hier lohnt der Einsatz eines Fernglases oder eines guten Teleobjektivs. Denn die Ablagerungen zeigen in der Nahaufnahme auch eine beeindruckende Vielfalt an Oberflächenstrukturen. Flächige Ablagerungen erscheinen manchmal wie kleine Lavaströme, Beckenränder erinnern an gefrorene Wasserfälle oder scheinen, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt mit hunderttausenden steinerner Pailletten besetzt zu sein. In diesen Momenten zahlt es sich einfach aus, wenn man nicht wie ein gehetztes Tier durch den Park jagen muss, weil man glaubt in 3 Wochen den ganzen Nordwesten und vielleicht noch mehr gesehen haben zu müssen. Wenn wir auch in unseren finanziellen Mitteln beschränkt sind, Zeit haben wir ausreichend und so gönnen wir uns alleine 2 Tage um bei dem im Yellowstone häufig sehr wechselhaften Wetter immer wieder neue Kamerapositionen zu suchen, um unser Bildarchiv zu komplettieren.
Die meisten Geyser Basins unterliegen einem ständigen Wechsel. Quellen die über Jahrzehnte hinweg zuverlässig Tag für Tag ihre heiße Fracht an die Oberfläche beförderten versiegen, während sich unweit davon neue auftun. Wo diese auf ehemals bewaldete Abschnitte trafen blieben auch in Mammoth Hot Springs die robusten Stämme stehen und gehen nun ihrer Versteinerung entgegen.

Manche Terrassen haben ein steinernes Paillettenkleid angelegt, was mit dem unbewaffneten Auge jedoch oft schwer zu erkennen ist.
Eine der inzwischen nicht mehr aktiven Quellen ist Liberty Cap, die wir auf dem Rückweg zum Parkplatz erreichen. Der konisch geformte Korpus wurde durch einen beständig fließenden Thermalwasserstrom über viele Jahre hinweg aufgebaut. Solange der Nachschub an Thermalwasser gewährleistet war, wurde Travertinschicht um Travertinschicht abgelagert, bis der Konus schließlich seine stattliche Höhe von mehr als 10 Metern erreichte. Vermutlich fand das Wasser im Untergrund neue Wege, möglich aber auch, dass er an seiner eigenen Fracht „erstickt“ ist, dass also Kalkablagerungen den Auslauf verstopften und das Wasser so neue Wege suchen musste.

Liberty Cap. Eine der inzwischen nicht mehr aktiven Quellen.
Am dritten Tag unseres Aufenthaltes geht es weiter nach Süden. Wir besuchen den Tower Fall und nochmals den Grand Canyon of the Yellowstone, der uns schon im Sommer sehr beeindruckte und laufen auf der Nordostseite des Parks einige kurze Wanderwege ab, um vielleicht doch irgendwann einmal den einen oder anderen Bären vor die Linse zu bekommen. So richtig ins Hinterland trauen wir uns aber immer noch nicht, weil die Besucherdichte hier ohnehin gering ist und nun im Herbst noch weiter abgenommen hat. Und unvermittelt alleine vor einem Bären zu stehen der spielen möchte nein, das muss immer noch nicht sein.
Am folgenden Morgen führt unser Weg zum Hayden Valley, wo wir am Rande eines Haltepunktes unweit der Straße einen Coyoten auf der Pirsch sehen. Über dem Grasland liegt noch zäher Nebel hinter dem die Sonne nur als fahle Scheibe erkennbar ist. Als wir aussteigen schaut der Coyote kurz zu uns rüber, und starrt dann sofort wieder konzentriert und in angespannter Körperhaltung stehend auf einen Punkt an dem er vermutlich einen Nager versteckt glaubt.
So kann ich in aller Ruhe den Fotoapparat herauskramen, Teleobjektiv und Stativ anbringen und unseren vierbeinigen Freund ablichten. Die durch den Nebel eingetrübte Sicht und der etwas zu große Abstand erlauben es aber nicht unseren vierbeinigen Freund formatfüllend auf die Linse zu bekommen und so entschließe ich mich dem Gesellen etwas näher auf den Pelz zu rücken. Nachdem die vermeintliche Beute offensichtlich einen sicheren Unterschlupf gefunden hat, wendet sich die Aufmerksamkeit des Coyoten nun mir zu. Mal sieht er mich direkt an, mal blickt er scheinbar teilnahmslos zur Seite, als wolle er mir damit sein Desinteresse oder vielleicht sogar seine Missachtung zum Ausdruck bringen. Während ich hoffnungsfroh näher an den bewegungslos verharrenden Vierbeiner herantrete, wird der nun doch etwas unruhig und als ich einen imaginären Sicherheitsabstand unterschreite setzt er sich langsam in Bewegung und trottet in Richtung des offenen Graslandes davon. Als ich schon umdrehen möchte, bleibt er wieder stehen und gibt mir mit einer Geste der Überlegenheit zu verstehen, wer hier das Heft in der Hand hat. Nun, denke ich, wenn du dir deiner so sicher bist, dann kannst du mich doch auch ein wenig näher heranlassen und bewege mich erneut auf ihn zu. Doch auch dieses Mal erreiche ich die rote Linie, die das Objekt meiner Begierde handeln lässt. Der Coyote ist aber weiterhin nicht gewillt zu dieser frühen Stunde unnötige Energien zu vergeuden und so tut er erneut nur das nötigste um mich auf Distanz zu halten. Das fordert mich ein weiteres Mal heraus und so wiederholt sich dieses Spiel sechs oder sieben Mal bis ich entnervt aufgebe. Das Biest hat mich doch tatsächlich so weit von der Straße weggelockt, dass ich unserem Van nur noch schemenhaft hinter mir erkennen kann und so darf ich nun den langen Rückweg antreten und sowohl der Coyote als auch ich bleiben ohne Beute zurück. Immerhin kann unser vierbeiniger, an Schläue kaum zu überbietender Freund nun zum gemütlichen Teil des Tages übergehen. Für uns geht es nun weiter zum Norris Geyser Basin und einigen Aussichtspunkten am Rande der Straße in Richtung Mammoth Hot Springs sowie an weiteren Aussichtspunkten entlang der Straße, von denen aus wir immer wieder Tiere beobachten. Als wir am Abend zu unserem Campingplatz zurückkehren staunen wir nicht schlecht. Dort hat sich eine Gruppe von etwa 20 Wapitis, angeführt von einem prächtigen Zwölfender breit gemacht. Eine weitere Herde sehen wir später im Rangerdorf und auf einem angrenzenden Sportplatz. Den Tieren schmecken offensichtlich die kurz geschnittenen, gut gewässerten und noch immer in vollem Saft stehenden Gräser in den Wohngebieten besser als die aus unserer Sicht zwar schön anzuschauenden, aber verdorrten Präriegräser in ihrem natürlichen Habitat.
Natürlich machen wir Fotos, doch irgendetwas stimmt mit dem Belichtungsmesser nicht und so fahren wir am Abend noch einmal nach Gardiner um eine neue Batterie zu kaufen, die das Problem aber nicht vollständig beheben kann. Möglicherweise hat die Elektronik den Unfall in Kanada oder die Kälte der letzten Wochen noch schlechter ertragen als wir und so mache ich mir nun doch Sorgen, ob die zahlreichen Fotos, die wir im Yellowstone aufnehmen konnten später wirklich die Qualität zeigen, die ich mir erhoffe.
So langsam heißt es Abschied nehmen. Und so geht es am frühen Morgen in gemütlicher Fahrt von Mammoth Hot Springs über Tower-Roosevelt und Grand Canyon in Richtung Yellowstone Lake. Auch heute liegen zahlreiche Nebelbänke über den Tälern und trüben in den ersten Tagesstunden die Fernsicht ein. Noch einmal frühstücken wir an einem der Haltepunkte entlang des Yellowstone Sees. Als sich die Nebelbänke auflösen strahlt die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel. Wir nutzen die Gunst der Stunde und sehen uns die Geysire am Westthumb des Yellowstone Lakes an. Am Nachmittag verlassen wir Yellowstone in Richtung Grand Teton National Park. Nachdem wir Quartier bezogen haben brechen wir am frühen Abend noch einmal zur Pirsch auf und gelangen über eine Schotterpiste auf einen kleinen Bergrücken von dem aus man einen herrlichen Blick über weite Teile des Tals hat. Wir genießen diesen wunderbar warmen Herbsttag, der uns kurzzeitig die Kälte der letzten Wochen vergessen lässt. Die abendliche Sonne überzieht das ganze Tal und die sich am Horizont auftürmenden Bergspitzen mit einem zunächst leuchtend gelben und später glutroten Farbanstri. Wir können uns gar nicht sattsehen an diesem grandiosen Szenario und so ist es bereits dunkel als wir den Rückweg zu unserem Campingplatz antreten.
Auch am folgenden Tag bleibt uns die Sonne treu und so steuern wir zahlreiche Aussichtspunkte entlang des Snake River, am Jackson Lake und an mehreren kleineren Seen südlich davon an. Auch an diesem Abend wieder das „Alpenglühen“, wir sind restlos begeistert. Uns gefällt diese grandiose Landschaft so gut, wir würden am liebsten die nächsten zwei Wochen hier verbringen, doch wir haben in den letzten Wochen einige ungeplante Stops zuviel eingelegt und so müssen wir uns nun ein wenig sputen.
Schon gegen 6:00 Uhr sind wir auf den Beinen, um in südlicher Richtung aus dem Park zu fahren. Die Sonne ist uns erneut hold. Im Dämmerlicht am Rande der Straße sehen wir einen Elchbock im hochgewachsenen herbstlichen Gras äsend. Zu dieser frühen Stunde ist niemand unterwegs und so lässt sich ein Elch, der gelegentlich von zwanzig oder mehr Teleobjektiven umzingelt ist von einem dieser verrückten Touristen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin natürlich wieder einmal total fasziniert von dem Prachtbullen und nähere mich immer weiter an, bis dieser mir durch einen strengen Blick und zwei Schritte nach vorn zu verstehen gibt, das es demnächst rumpelt, wenn ich mich nicht schleunigst aus seinem Intimbereich entferne. Ich erinnere mich dunkel gelesen zu haben, dass mehr Touristen von Elchen und Büffeln, denn von Bären verletzt werden und auch wenn der Elch keine Anstalten machen würde an mir herum zu knabbern wäre es doch sehr schmerzhaft von diesem über den Haufen gerannt zu werden oder einen ordentlichen Tritt mit den Hufen zu erhalten. Schließlich können wir beide uns auf eine Entfernung einigen, die mir formatfüllende Fotos liefert und ihm die notwendige Ruhe zum äsen verschafft. Nachdem ich wieder einmal meine Lektion gelernt habe gönnt mir „Ihre Lordschaft“ auch alle Zeit der Welt mein unverständliches Treiben fortzuführen. Am Ende ist es nicht der Elche, der mich auf die Straße zurücktreibt sondern Angelika, die es sich nach einem kurzen Blick auf unseren Prachtburschen im warmen Auto gemütlich gemacht hat und der es allmählich zu langweilig wird. Also setzen wir unseren Weg nach Süden fort und brechen in Richtung Utah auf.









Kommentar schreiben